Tipp
Erfolgreich studieren an der EPFL Lausanne: Tipps & Tricks
 |

Die École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL): Eine Hochburg der Wissenschaft
Die École polytechnique fédérale de Lausanne gilt als Hochburg der Forschung und als eine der ersten Adressen für Biowissenschaften, Technik, Physik, Chemie und Fächer ähnlicher Ausrichtung (Listung: http://bachelor.epfl.ch/programmes). Knapp über 7'000 Studenten bevölkern Campus und Hörsäle der Hochschule in Lausanne und machen den Hochschulbetrieb lebendig. Mit ihrer streng wissenschaftlichen Ausrichtung betont die École polytechnique fédérale de Lausanne gleich eingangs, dass trotz guter Strukturierung des Studiums der Erfolg massgeblich von der Disziplin und Arbeitswilligkeit des Einzelnen abhängt. Ein Studium an der EPFL ist allemal ein Vollzeitjob, der ganzen Einsatz erfordert. Doch der übersichtliche Rahmen und die große Transparenz ermöglichen gute Orientierungsmöglichkeiten in diesem hochwissenschaftlichen Betrieb. Nicht zuletzt dürfte die Tatsache, dass ein erfolgreich an der EPFL absolviertes Studium die beste Visitenkarte im Berufsleben überhaupt ist, ein Ansporn sein.
Von: Marijana Babic
Grundsätzliches: Studienerfordernisse an der EPFL
Jeder Aspirant muss sich aber darüber im Klaren sein, dass an der EPFL Selbstdisziplin und Arbeitswille absolut vorausgesetzt werden. Die Vorteile der EPFL liegen jedoch auf der Hand: Das Studium bietet konkrete Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten. Angewandte Mathematik zum Beispiel birgt erhebliche Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, vor allem wenn im späteren Berufsleben die Industrie der Zielpunkt ist. Studien an der EPFL sind somit eine unmittelbare Vorbereitung für ein erfolgreiches Berufsleben. Studien an der EPFL sind aber auch besonders intensiv und erfordern nicht nur gutes Organisationsvermögen, sondern auch Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit. Dieser Tatsache ist man sich an der EPFL bewusst. Das Angebot SAE bietet deswegen zum Beispiel Möglichkeiten, um Techniken des Lernens, Behaltens und Präsentierens zu üben. Das Büro ist nach Absprache geöffnet. Kontakt: Student Services, E-Mail: student.services@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45. Hier bietet sich auch die Gelegenheit, Kontakte zu denjenigen Studenten zu knüpfen, die ähnliche Fragen bewegen. An der EPFL ist es auch grundsätzlich wichtig, sich frühzeitig zu Arbeitsgemeinschaften zusammenzuschliessen und den Kontakt zu Kommilitonen zu pflegen. Der intensive Lehrstoff ist nur durch Planen, Konsequenz und soziale Integration zu bewältigen. Möglich ist es auch, zunächst ein Vorbereitungsjahr zu absolvieren, um von der Lawine der Wissenschaft nicht gleich überrollt zu werden und eine Akklimatisationsphase zu durchlaufen (Informationen unter: http://bachelor.epfl.ch/files/content/sites/bachelor/files/shared/brochu...). Nützliche Broschüren als Einstiegslektüre über ein Studium an der EPFL stehen unter http://bachelor.epfl.ch/page-5909-de.html zum Download bereit. Im Folgenden finden sich die wichtigsten Tipps und Anlaufstellen, um an dieser renommierten und fordernden Hochschule, die einige weltweit herausragende Wissenschaftler beherbergt, erfolgreich zu sein.
Ein wichtiges Instrument zur Orientierung: Website der EPFL
Um auf dem Laufendem zu bleiben und um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, ist ein regelmässiger Besuch der Website http://www.epfl.ch/ von Vorteil. Sie ist gespickt mit äusserst wertvollen Informationen, die Navigation ist einfach und benutzerfreundlich. Die Seite ist dabei vorwiegend in Französisch gehalten, streckenweise steht auch eine englische Sprachauswahl zur Verfügung. Nur ein kleiner Teil ist in Deutsch übersetzt.
Nicht verpassen: Einführungsveranstaltungen zum Reinschnuppern
An der EPFL finden die nächsten Einführungstage für Studieninteressierte vom 10. bis zum 11. März sowie vom 17. bis 18. März 2011 statt. Dabei werden alle Bachelorfächer ausführlich präsentiert, auch Lehrende stellen sich vor. Kontaktperson ist Ingrid de Mesel (E-Mail: ingrid.demesel@epfl.ch, Telefon +41 (0)21 693 5071), die auch erste Fragen vorab telefonisch beantworten kann. Diese Einführungstage sind sehr empfehlenswert, um erstmals die Luft der EPFL zu schnuppern, sich einen Eindruck vom Betrieb zu verschaffen und möglicherweise auch schon Kontakte zu knüpfen, die später hilfreich sein können. Die Einführungstage vermitteln einerseits die faszinierende Welt der Wissenschaft, wie sie in Lausanne gelehrt wird, andererseits können sie sicher auch Entscheidungsfragen erleichtern. An anderen Hochschulen, besonders für den Bereich Kunst, bietet man den Studenten in spe Mappenvorbereitungskurse an. Die Wahrscheinlichkeit, einen Studienplatz zu erhalten, steigt und man kann sich durch einen Kurs schon ein wenig auf das Studium einzustimmen und sein Talent testen.
Struktur der EPFL: Studienabschlüsse, Unterrichtssprache, Zulassung
Die EPFL bietet klassisch gemäss der Bologna-Reform Bachelor- und Masterstudiengänge an. Um den Bachelor-Grad zu erreichen, müssen 180 Kreditpunkte (Leistungsnachweise) erbracht werden, für den Master sind weitere 120 erforderlich. Zugelassen wird grundsätzlich jeder, der eine Schweizer Maturität oder einen vergleichbaren, anerkannten Abschluss vorweisen kann. Bei sonstigen ausländischen Abschlüssen muss die Zulassung geklärt werden (Hilfe für diese Fragen gibt es beispielsweise bei: Studienhilfe, E-Mail: services.etudiants@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45). Im Zweifel sollte ebenfalls erfragt werden, ob die Zeugnisse in einer beglaubigten Übersetzung vorgelegt werden müssen. In diesem Fall empfiehlt es sich, ein professionelles Übersetzungsbüro damit zu beauftragen. Die Unterrichtssprachen sind Französisch, da Lausanne in der französischsprachigen Schweiz liegt, und Englisch. Für die jeweilige Unterrichtssprache sollten mindestens Kenntnisse auf dem Level C1 nach internationalem Standard vorliegen, um erfolgreich am Hochschulbetrieb teilnehmen zu können. Um etwaige Sprachdefizite auszugleichen, gibt es das Sprachenzentrum, das Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch auch in Intensivkursen anbietet (http://langues.epfl.ch/). Empfehlenswert ist – wie meist – das Tandemsystem: das heisst, zwei Muttersprachler verschiedener Sprachen verbinden sich und lernen zusammen. Für das Sprachenzentrum kann sich jeder online auf der genannten Website kostenlos anmelden.
Mathematikkenntnisse
Die EPFL ohne Mathematik ist nicht denkbar. Fortgeschrittene Mathematikkenntnisse sind an der Hochschule auf jeden Fall von Vorteil (mit Ausnahme des Fachs Architektur, das anders ausgerichtet ist). Die Wahrscheinlichkeit, das erste Studienjahr zu überstehen, ist dann statistisch gesehen erheblich grösser. Doch wer glaubt, über diese Kenntnisse nicht zu verfügen, muss nicht verzagen: In dem Kurs „PolyMaths“ werden jeweils im Frühjahr mathematische und physikalische Fertigkeiten auf wissenschaftlichem Niveau vermittelt. Der Kurs gilt als beste Einführung in die polytechnischen Studiengänge überhaupt (der Link zum Kurs befindet sich unter http://bachelor.epfl.ch/cms/site/bachelor/op/edit/page-5808.html). Abgesehen davon werden die Mathematikkenntnisse jedes Einzelnen schon vor Studienbeginn ausgewertet. Für mögliche Defizite können dann zielgerichtet Lösungen gesucht werden. Ausserdem wird allen Studienanfängern das französischsprachige Buch „Savoir-faire en mathématiques pour bien réussir à l'EPFL“ vor Beginn ausgehändigt, das sich ausführlich mit dem Thema Mathematik und EPFL beschäftigt, aber auch die Wichtigkeit dieses Fachs für das Studium unterstreicht. Die Hochschule weist aber auch klar darauf hin: Um an der EPFL erfolgreich studieren zu können, muss man Spass an der Mathematik haben und gerne praxisorientiert mit ihr arbeiten. Der Wille zu permanenter Zielstrebigkeit und Konsequenz bei der Anwendung mathematischer Kenntnisse gehört ausserdem dazu.
Stundenpläne und Studienhilfe: Wichtige Adressen
Hilfe für die Erstellung der enorm wichtigen Stundenpläne bietet folgender Link: http://bachelor.epfl.ch/cms/page-5911.html. Dort gibt es Kursbeschreibungen und Stundenpläne für das erste Studienjahr. Wissenswertes über die Bachelor-Angebote ist erhältlich unter http://bachelor.epfl.ch/cms/op/edit/lang/en/programmes. Dabei werden auch die jeweiligen Kontaktpersonen auf der rechten Leiste gelistet, wenn das entsprechende Fach aufgerufen wird. Das sind die Ansprechpartner, die Informationen rund um das Fach geben können.
Studienhilfe
Stets mit dabei ist der Hinweis auf die Studienhilfe bzw. Studienberatung (Guichet des étudiants oder Student Help Desk): E-Mail services.etudiants@epfl.ch, Telefon +41 (0) 21 693 43 45. Diese Anlaufstelle sollte jeder Studienanfänger aufsuchen, am besten noch vor Studienbeginn, denn sie kümmert sich um alle studentischen und akademischen Belange. Auf der Seite für Anfänger im Bachelor-Studium sind alle Immatrikulationsfristen und sonstigen Erfordernisse wie Einreichungsunterlagen für die Immatrikulation für das Studium an der EPFL gelistet. Die Studienberatung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wo die Studienberatung zu finden ist? Dies zeigt der Lageplan unter http://plan.epfl.ch/?lang=fr&room=bp+1229. Die Studienhilfe empfiehlt allen Studienanfängern regelmässig die Seite http://studying.epfl.ch/bienvenueBachelor aufzusuchen und sich nach dem Neuesten zu erkundigen. Die Seite bietet ausserdem Tipps per Video, wie sich Studenten in Kurse einschreiben können. Die Studienhilfe organisiert ebenfalls die Vermittlung „Studenten antworten Studenten“: http://bachelor.epfl.ch/studentsonline. Ein durchaus nützliches Angebot, denn wer kann Studienanfänger besser verstehen als Studenten selbst? Das Forum ist auch ein wichtiges Instrument, um sich zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Hilfreich ist die Studienberatung auch, wenn der akademische Nachwuchs vor der Frage steht, welcher Schwerpunkt für das Studium gewählt werden sollte. Denn an der EPFL ist die Festlegung auf einen Schwerpunkt im jeweiligen Fach erforderlich. Da diese Entscheidung wegweisend ist für das weitere Studium ist, sollte jeder Studienanfänger die Beratungsmöglichkeiten der Studienberatung in Anspruch nehmen. Diese kann auch helfen, falls ein Student bei seiner Entscheidung falsch lag und einen Wechsel möchte. Wer sein Studium erst beginnen möchte und fachlichen Rat braucht, kann ein persönliches Gespräch vereinbaren, das diskret behandelt wird.
Immatrikulation: Wie schreibe ich mich ein?
Die Immatrikulation erfolgt online, wobei die Online-Plattform nur vom 18. Januar bis zum 30. April geöffnet ist. Die Anmeldung wird ausgefüllt, ausgedruckt und per Post an die EPFL verschickt. Unter http://bachelor.epfl.ch/page-5915.html ist aufgeführt, was noch zur Immatrikulation vorgelegt werden muss. Die Postadresse, an die die Unterlagen geschickt werden, ist: EPFL AA-DAF SAC, Bâtiment Polyvalent 1233, Station 16, CH-1015 Lausanne. Kontaktadresse ist: Telefon +41 (0)21 693 43 45, E-Mail services.etudiants@epfl.ch. Die Studiengebühren betragen 633 CHF pro Semester.
Bibliothek: Wie komme ich am besten an Wissen?
Das Bibliothekssystem in Lausanne arbeitet mit dem Verbund NEBIS und umfasst rund 4,2 Millionen Bände, wozu noch Zeitschriften, elektronische Zeitschriften, E-Books, etc., hinzukommen. Studenten der EPFL haben automatisch eine Berechtigung für die Bibliothek. Die umfassende Dokumentenarchivierung erfolgt nach einem bestimmten System, mit dem sich die Studenten vertraut machen sollten. Um ein Buch o.Ä. zu finden, wird der Katalog NEBIS benutzt: www.nebis.ch. Hier kann auch ausgeliehen werden, können zum Beispiel Zeitschriftenartikel bestellt oder Fernleihen in Auftrag gegeben werden. Das System ist benutzerfreundlich und arbeitet mit Stichwortsuche nach Autor und/oder Titel. Die Bibliothek ist praktischerweise sieben Tage die Woche von 7 bis 24 Uhr geöffnet. Sie befindet sich im Rolex Learning Center, Station 20, in Lausanne und ist auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. Kontakt: +41 (0)21 693 2156 oder E-Mail questions.bib@epfl.ch. Nach Absprache gibt es auch Schulungs- und Trainingsmöglichkeiten, um sich in das System der Bibliothek einführen zu lassen. Da der fachgerechte Umgang mit Literatur für ein erfolgreiches Studium unerlässlich ist, sollte sich jeder Studienanfänger zu mindestens einer Führung einfinden und sich ausführlich in die Bibliothek einweisen lassen.
Austauschprogramme: Der Draht zur Welt
Die EPFL bietet Bachelor-Studenten im dritten Jahr einen Aufenthalt in einer der 190 Partneruniversitäten weltweit an. Studenten, die ausserhalb Europas ein Austauschprogramm belegen wollen, müssen einen Durchschnitt von mindestens 5.0 vorweisen können, Austauschwillige, die innerhalb Europas ein Auslandssemester planen, einen Durchschnitt von 4.5. Weitere Bedingung ist, dass nach dem zweiten Bachelor-Jahr mindestens 60 Kreditpunkte erreicht wurden. Die Leistungen, die im Austauschprogramm erbracht werden, werden an der EPFL angerechnet. Die Ansprechpartner für die jeweiligen Fächer/Teilgebiete finden sich unter http://jahia-prod.epfl.ch/repository/default/content/sites/sae/files/sha.... Eine Liste der Partneruniversitäten ist unter http://sae.epfl.ch/page-27066-en.html erhältlich, wobei das jeweilige Fach angeklickt werden muss. Antragsformulare können unter http://sae.epfl.ch/files/content/sites/sae/files/shared/FORMUL2010-11.pdf gefunden werden. Es ist auch angeraten, die Informationsveranstaltungen zum Thema Auslandsemester im Herbst vor dem Austausch zu besuchen. Die Termine sind unter http://sae.epfl.ch/page-33555-en.html gelistet. Da Studenten der EPFL häufig einen beruflichen Werdegang in der international operierenden Industrie anstreben, ist es notwendig, sich die entsprechenden kulturellen, sozialen und sprachlichen Fertigkeiten anzueignen. Neben der eigenen Bereicherung durch einen Auslandsaufenthalt ist dieser daher auch ein förmliches Muss für künftige Bewerbungsgespräche. Studenten, die an der EPFL ein Austauschsemester o.Ä. absolvieren wollen, müssen von ihrer jeweiligen Hochschule dazu ausgewählt worden sein. Entsprechende Französischkenntnisse sind dafür unabdingbar. Wesentliche Informationen für Studenten, die zeitweise an der EPFL studieren wollen, gibt es unter http://sae.epfl.ch/page-27094-en.html.
Behindertengerecht: Hilfe barrierefrei
Die EPFL bemüht sich besonders, auch behinderten Personen gerecht zu werden. Die Bibliothek beispielsweise ist barrierefrei. Nützliche Adressen, die auch bei der Bewältigung des Studienalltags helfen können, sind unter http://sae.epfl.ch/page-27104-en.html gelistet. Hilfreich ist auch das Team des SAE, das Büro ist aber nur nach Absprache geöffnet. Kontakt: Student Services, E-Mail: student.services@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45.
Wie finde ich mich an der EPFL zurecht?
Einen Lageplan gibt es unter https://documents.epfl.ch/groups/e/ep/epfl-unit/www/plan/EPFL-plan-campu.... Studienanfänger sollten rechtzeitig beginnen, sich auf dem Campus zu orientieren und möglicherweise zu Beginn frühzeitig zu Kursen aufbrechen, um diese auch zu finden. Der Vorteil der EPFL ist, dass es sich um einen (wenn auch großen) Komplex handelt und nicht um viele über die Stadt verstreute Gebäude. Dies kommt behinderten Personen entgegen, hilft aber auch bei der Orientierung von Studienanfängern.
|
Studentische Organisationen: Kontaktmöglichkeiten und Chancen Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Bachelorarbeit - Wie finde ich ein Thema?
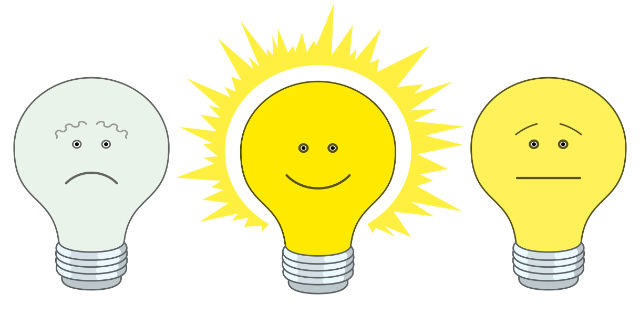 |

Nun ist es soweit: Nach all den erfolgreich bestandenen Kursen steht deinem Abschluss jetzt nur noch die Abschlussarbeit im Weg. Doch über welches Thema möchtest du schreiben? Falls du dir diese Frage immernoch stellst und bei der Themenfindung nicht weiterkommst, empfehlen wir dir folgendermassen vorzugehen:
Von: Gary
1. Zuerst solltest du entscheiden, von welchem Professor du betreut werden möchtest. Das ist wichtig für die Note, denn manche Professoren haben den Ruf, gute Noten zu vergeben, während andere dafür bekannt sind, ihren Studenten schlechte Noten reinzudrücken. Eigentlich ist die Abschlussprüfung nicht der richtige Moment für Idealismus, aber wer dennoch meint, dass man sich den Betreuer nicht nach den Noten aussuchen sollte, sondern nach anderen Kriterien, sollte dies auch tun. Oft hat man das Glück, dass die nettesten Professoren in der Wahl deines Abschlussthemas flexibel sind.
2. Überlege, welches Themengebiet dich so sehr interessiert, dass du monatelang dafür Begeisterung aufbringen kannst. Es gibt nichts schlimmeres als sich nach einigen Wochen über das Thema zu langweilen! Mache dazu eine Brainwriting-Session, indem du alle Themen aufschreibst, die dich während des Studiums gepackt haben und ordne sie in eine Rangliste. Konzentriere dich ab jetzt nur noch auf die Top 3 und verwirf die anderen Themen.
3. Überlege nun, ob dich eine praktische oder empirische Arbeit interessiert oder ob du lieber mit Theorien arbeitest.
4. Finde als nächstes in Fachzeitschriften, im Internet und in Gesprächen mit deinem Professor heraus, welche Fragen gerade in den 3 Themengebieten, die du im Brainwriting gesammelt hast, “heiss” oder “in” sind. Ein Beispiel: Du interessierst dich für das Thema “Evolutionspsychologie” und findest in deiner Recherche heraus, dass es derzeit unter Wissenschaftlern eine heisse Debatte darüber gibt, ob sich irrationales Verhalten von Aktionären evolutionspsychologisch erklären lässt.
5. Schreibe darauffolgend je 10 Emails an Experten in diesen Feldern und frage sie, ob es eine Frage gibt, die sie gerne beantwortet hätten oder ob ihnen ein Thema in ihrem Gebiet einfallen würde, das als Bachelorarbeit geeignet wäre.
6. Trage nun alle Themenvorschläge zusammen und wähle das Thema aus, das dich am meisten anspricht. Es ist sinnvoll, die folgenden Kriterien anzuwenden:
Aufwand: Welche Daten müsstest du beschaffen? Welche Bücher und Artikel müsstest du lesen? Wie schwer ist es, an sie heranzukommen?
Relevanz: hättest du bei diesem Thema das Gefühl, in der Tat etwas zu erarbeiten, das jemanden interessieren könnte (und wenn es nur ein paar Fachexperten sind!)?
Lernpotential: Wieviel würdest du methodisch oder inhaltlich bei der Erstellung der Arbeit lernen, das später nützlich für dich sein könnte?
Schwierigkeitsgrad: Wähle kein Thema aus, das du nicht bewältigen kannst! Es wäre schade unnötig eine schlechte Note zu bekommen, weil du dich übernommen hast.
7. Bespreche nun deine Themenwahl mit deinem Betreuer. Falls er Änderungen vorschlägt, solltest du erst einmal gründlich darüber nachdenken. Falls du der Meinung bist, dass diese Änderungen Probleme verursachen würden, die dein Betreuer übersehen hat (dies kann vorkommen, denn du kennst dich möglicherweise in diesem Themengebiet jetzt schon besser aus als er). Hier kommt es darauf an, mit deinem Betreuer etwas auszuhandeln und nicht 1:1 das zu übernehmen, was er vorschlägt.
Vergiss nicht, dass dies womöglich deine letzte wissenschaftliche Arbeit ist - sie sollte also Spass machen, denn schliesslich möchtest du die Uni-Zeit in guter Erinnerung behalten.
Viel Erfolg!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren - 8 Merkmale

Studenten mit Erfolg haben gute Lernstrategien bzw. gehen nach bestimmten Techniken vor und wenden diese beim Lernen an. Wir haben 8 Techniken für euch zusammengetragen:
Von: Max
1. In Massen:
Erfolgreiche Studenten studieren in Massen. Sich mit zu viel Arbeit zuzuschütten hilft nicht. Ganz im Gegenteil: man hat das Gefühl, gar nicht voranzukommen und gibt schnell auf. Daher sollte man sich das Lernpensum immer in Massen und durchführbar einteilen.
2. Immer zur selben Zeit:
Routinen helfen vor allem beim Lernen, da sich der Körper dem Lernen als Teil des normalen Tagesablaufs anpasst. Die Aufwärmphase, bis man auf “geistiger Betriebstemperatur“ ist, verkürzt sich und man kann direkt loslegen mit dem Lernen.
3. Setze Ziele:
Wenn man weiss, was man will, ist man erfolgreicher. Ziele helfen beim Studieren und reduzieren die Gefahr, den Faden zu verlieren. Vor allem wenn man viel Stoff zu bewältigen hat, ist es gescheit, vorher zu überlegen, bis wann was erledigt sein soll.
Genauso wichtig wie die Ziele zu bestimmen ist, deren Überprüfung. Hast du geschafft, was du dir für die Lernsession vorgenommen hast, oder musst du dir beim nächsten Mal etwas weniger vornehmen?
4. Folge deinem Lernplan:
Stell sicher, dass du wirklich dann anfängst, wann du es auch geplant hast, und nicht Überraschungen in Form von Freunden oder deiner Lieblingsserie anstehen, um dich abzulenken. Lernen ist in vielen Fällen nicht so schön wie Hobbies oder Freizeit, kann, wenn du es durchdacht einteilst, aber weniger belastend sein.
5. Konzentriere dich zuerst auf die schwierigsten Probleme oder Aufgaben:
Wenn du mit den schweren Aufgaben anfängst, bist du noch frisch und dein Kopf ist fit. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir der richtige Weg einfällt und du produktiv bist, ist viel höher. Die leichteren Aufgaben kannst du danach angehen und dich somit “belohnen“.
6. Suche Hilfe:
Es gibt Aufgaben, die man zwar alleine lösen könnte, jedoch nicht ohne sich die Haare zu raufen oder wutentbrannt Sachen durchs Zimmer zu werfen. Zögere nicht, Mitstudenten,Tutoren oder Professoren um Rat zu fragen. Auch Lerngruppen machen für bestimmte Fächer Sinn.
7. Mach Pausen:
Wenn du während der Lernerei merkst, dass deine Konzentration abnimmt oder du müde wirst, mach eine viertel Stunde Pause und geh raus. Bewege dich und entspanne. Besonders deine Augen brauchen Abwechslung. Schau auf entfernte Gegenstände und dann wieder auf nahe. Du wirst merken, wie es hilft.
8. Wiederhole den Stoff:
Jede einzelne Vorlesungs- oder Unterrichtsstunde nachzuarbeiten ist natürlich nicht möglich. Aber einfach kurz überfliegen, wenn nicht zuhause, dann eben vor der nächsten Stunde, hilft dir, dich schneller auf die neue Stunde einzustellen. Die besten Lehrer wiederholen zu Beginn einer neuen Stunde den Stoff der letzten Stunde noch mal kurz. Das tun jedoch nicht alle. Besonders an der Uni wird selbstständiges Nacharbeiten und Vorbereiten vorausgesetzt. Wäge ab, für welche Fächer du mehr und für welche weniger machen musst.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
11 Tipps eines Absolventen, um glĂĽcklich und erfolgreich zu studieren

Mit dem Studium beginnt ein neuer Lebensabschnitt und damit auch eine grosse Herausforderung. Um das meiste aus dem Studium herauszuholen, kann es hilfreich sein, mit Absolventen zu sprechen, denn sie können dich auf typische Fehler hinweisen und dir Tipps geben, wie du diese vermeidest. Aus meiner Sicht - ich habe bis Ende 2008 VWL und Politik studiert - haben Studenten die besten Voraussetzungen für ein glückliches und erfolgreiches Studium, wenn sie die folgenden Tipps befolgen:
Von: Gary
1. Das 1. Jahr ernst nehmen
Die meisten Studiengänge sind so aufgebaut, dass das erste Jahr besonders anspruchsvoll und lernintensiv ist, um schon früh festzustellen, wer für das Studium geeignet ist und wer nicht. Deshalb solltest du in dieser Zeit soviel wie möglich Motivation und Energie aufbringen. Sei dir darüber im Klaren, dass es im 2.Jahr und danach mit hoher Wahrscheinlichkeit leichter wird. Aus 3 Gründen: die harten, "aussiebenden" Kurse hast du schon im 1.Jahr belegt, du hast dich jetzt eingelebt und bist mit dem Stoff vertrauter, und du hast mehr Wahlkurse. Falls du also gerade im 1.Jahr bist und verzweifelst, Augen zu und durch!
2. Sich fragen, was man sich vom Studium verspricht
Du wirst viel motivierter sein, wenn du weisst, wofür du das alles eigentlich machst. Möchtest du eines Tages für eine bestimmte Firma arbeiten? Möchtest du einfach nur viele Optionen haben, wenn du die Uni verlässt? Oder hast du einfach nur Spass am Lernen? Nur wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, wirst du das volle Leistungspotenzial aus dir schöpfen können.
3. Keine Angst vor einem Abbruch haben
Wenn du nach 2 Semestern unglücklich über dein Studium bist, wechsle die Hochschule oder das Fach, je nach dem, wo das Problem liegt. Es lohnt sich. Selbst wenn du das Fach wechselst, wirst du vielleicht einige Scheine anrechnen lassen können, aber selbst wenn nicht, ein Neuanfang bedeutet nicht, dass du dein 1.Jahr verschwendet hast. Im Gegenteil: durch das 1.Jahr hast du gelernt, was du wirklich wirst und ausserdem hast du bestimmt auch gut gefeiert!
4. Wissen, worauf es ankommt
Die allermeisten Studenten machen nicht zu wenig sondern zu viel für das Studium (jedenfalls war das in meinen Fächern Politologie und VWL der Fall). Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern nur das, was dich entweder interessiert oder was höchstwahrscheinlich in einer Prüfung oder Hausaufgabe abgefragt wird. Aber selbst in letzterem Fall solltest du gründlich abwägen, ob du dich wirklich so sehr mit dem Material beschäftigen möchtest bzw. ob es sich für den Aufwand wirklich lohnt.
Beispiel 1: Du bist im Grundstudium und sollst in einem Kurs eine Hausarbeit schreiben, deren Note 5 % deiner Gesamtnote ausmachen wird und die wiederum nur 10% der Kursnote ausmacht. Insgesamt ist die Hausarbeit also nur 0,5% der Gesamtnote wert. Nehmen wir an, dass du mit viel Aufwand eine 1,5 bekommen würdest. Ohne Aufwand bekommst du hingegen eine 3,0. Du hättest also deine Gesamtnote um 0,15% verbessert. Wenn dieser Aufwand daraus besteht, dass du eine Woche lang recherchieren und schreiben müsstest, obwohl du in der gleichen Zeit für eine überaus wichtige Klausur lernen könntest, oder eigentlich die Bewerbungsfristen für Auslandsaufenthalt und Stipendien einhalten musst, dann solltest du unbedingt sorgfältig überlegen, ob es das wert ist.
Beispiel 2: Du bekommst jede Woche Lesematerial von deinen Dozenten, das nicht überaus erforderlich ist, um das behandelte Thema zu verstehen, sondern nur ergänzend ist. Lies diese Texte tatsächlich nur, wenn sie dich interessieren. Falls Inhalte aus den Texten mal doch in den Prüfungen abgefragt werden sollten, solltest du die Texte rechtzeitig zusammenfassen (am besten auf Karteikarten) aber noch nicht auswendig lernen, denn oft vergisst man es sowieso bis zur Prüfung und muss es dann nochmals lernen. Doppeltes Lernen ist verschwendete Zeit, die du hättest viel produktiver in dein Studium investieren können.
5. Zusatzkompetenzen erlernen
Nach dem Studium werden Arbeitgeber nicht nur auf deine fachspezifischen Kenntnisse schauen, sondern auch bestimmte Zusatzqualifikationen verlangen oder zumindest sehr gerne sehen. Hier einige Vorschläge: Excel, Powerpoint, ein Statistikprogramm (etwa SPSS oder Stata), ein Content Management System (etwa Joomla oder Wordpress), HTML, ein Grafik-Programm (etwa Photoshop oder InDesign) oder Fremdsprachen.
6. Das Studium ist mehr als nur ein Studienfach
Das Studium bietet dir eine einmalige Gelegenheit, deine Allgemeinbildung aufzupeppen. Im Vorlesungsverzeichnis wirst du viele spannende Vorlesungen finden, in die du dich einfach mal reinsetzen kannst. Zudem finden an allen Hochschulen immer wieder Sonderveranstaltungen statt, die du besuchen kannst, zum Beispiel Vorträge, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Workshops. Hier kannst du ganz ohne Druck lernen.
7. Nicht nur für die Uni leben
Es macht viel Sinn, dich auch fernab der Universität zu beschäftigen. Aus 2 Gründen: Wenn du eines Tages die Uni verlässt, wirst du auch weiterhin ein Hobby und ein soziales Netzwerk haben wollen. Ausserdem ist es sehr hilfreich, einen Ausgleich zur Uni zu haben.
8. Mit Professoren sprechen
Du bist als Student in der glücklichen Position von absoluten Experten umgeben zu sein. Nutze diese Gelegenheit und stell nach der Vorlesung oder in der Sprechstunde Fragen. So lernst du gutmöglich Sachen, die du sonst nicht gelernt hättest und findest viel leichter Interesse zum Thema. Daher ist es vor allem dann eine gute Idee, Kontakt mit Professoren zu suchen, wenn du einen Motivations-Durchhänger hast.
9. Ein Netzwerk aufbauen
Nach der Studienzeit wirst du immer wieder Zustände erleben, in denen ein grosses Netzwerk an Freunden und Bekannten aus der Universität sehr helfen kann: etwa als Übernachtungsmöglichkeit, bei der Jobsuche, als Lebensberater oder als Geschäftspartner. Nutze Facebook &Co. um auch über das Studium hinaus mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben.
10. Mindestens ein Semester im Ausland verbringen
Fast jeder Student, der für eine gewisse Zeit ein Auslandsstudium gemacht hat, wird diese Zeit zu der besten Zeit seines Lebens zählen. Du lernst eine andere Kultur kennen, machst neue Bekanntschaften und lernst vor allem über dich selbst viel. Ab zum Auslandsreferat!
11. Carpe diem – den Tag nutzen
Sei dir deiner Freiheit als Student bewusst und geniesse sie. Leiste etwas, aber hab auch Spass dabei. Die richtige Balance zu finden ist eine grosse Herausforderung, aber es ist die Mühe wert, viel darüber nachzudenken, wie du das meisterst. Denn die glücklichsten Studenten sind meist diejenigen, die genau die richtige Balance für sich gefunden haben.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Die perfekte PrĂĽfungsvorbereitung!
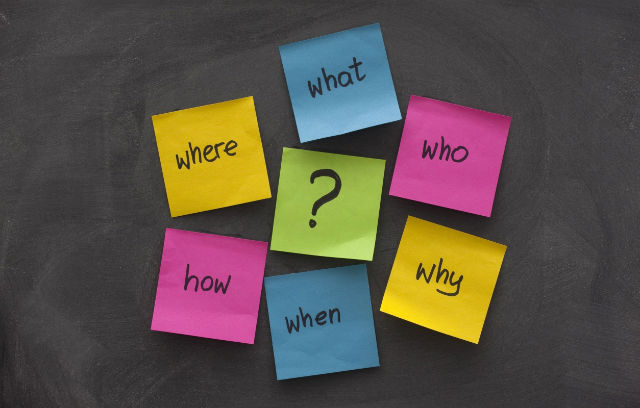 |

Bei Prüfungen kommt es besonders darauf an, in guter Verfassung zu sein und strategisch klug vorzugehen. Folgende Tipps zur Prüfungsvorbereitung helfen dir dabei:
Von: BrainEffect-Team, 08. Mai 2010
Zu einer idealen Prüfungsvorbereitung gehört ein ausgiebiges und nährstoffreiches Frühstück, um genug Energie für die Prüfung zu tanken. Eines der Hauptgründe für Konzentrationsstörungen ist eine unausgewogene oder mangelhafte Ernährung. Achte aber auch darauf, die Prüfung nicht mit vollem Magen anzugehen.
Vermeide es, die Nacht vor der Prüfung “durchzumachen”. Du solltest schon mindestens 3 Stunden Schlaf bekommen. Stehe 2 Stunden vor der Prüfung auf, um genug Zeit zu haben, wieder fit zu werden.
Stell an deinem Wecker 2 Weckzeiten ein um sicherzustellen, dass du auch pünktlich aufstehst. Wenn du verschläfst, war all die Vorbereitungsmühe umsonst!
Zwing dich, vor der Prüfung aufs Klo zu gehen.
Nimm eine Uhr mit in die Prüfung, um dir deine Zeit einteilen zu können.
Wenn du den Aufgabenzettel bekommst, überfliege alle Aufgaben, um in etwa zu sehen, wie du dir die Zeit einteilen musst.
Rechne für die 2.Prüfungshälfte etwa doppelt soviel Zeit ein wie für die erste, denn die hinteren Aufgaben sind meist länger und desweiteren wirst du noch einen Puffer brauchen.
Behalte während der Prüfung eine positive, lockere Grundhaltung. Solltest du doch nervös werden, schau vom Aufgabenblatt weg, guck in die Gegend, denk an etwas Schönes (den Freund/die Freundin, eine Party, auf die du dich freust, das letzte Erfolgserlebnis) und atme ein paar Mal tief ein und aus, um dich zu entspannen.
Arbeite zuerst an den einfachen Aufgaben. Halte dich aber nicht zulange an einer Aufgabe auf, wenn du an einer Stelle feststeckst. Schreib dir auf einem Schmierzettel auf, welche Gedanken du dir schon gemacht hast, damit du später den Gedankengang an der selben Stelle wieder aufnehmen kannst. Gehe zur nächsten Aufgabe über und später noch einmal auf die problematische Stelle zurück; oft wird einem vieles klarer, indem man die anderen Fragen bearbeitet.
Von den einfachen Aufgaben: Bearbeite zuerst die, bei denen es die meisten Punkte gibt.
Zögere nicht, den Kursleiter zu fragen, wenn eine Aufgabe bzw. Frage unklar gestellt ist.
Lies dir die ganze Frage genau durch und achte darauf, dass du keine Annahmen machst, die nicht in der Frage stehen.
Schreib leserlich. Punktabzüge wegen Unleserlichkeit sind unnötig und verdammt ärgerlich.
Schreib nicht mehr als notwendig, das verschwendet nur Zeit. Du kannst aber schon immer wieder mal einzelne Details einstreuen, um deinem Professor zu zeigen, dass du dich auch in der Tiefe auskennst. Es kommt auch sehr gut an, Beispiele für einen bestimmten Sachverhalt zu nennen.
Lass dich nicht von Studenten irritieren, die vor dir fertig sind. Oft ist es ein Zeichen von Ahnungslosigkeit oder Faulheit, wenn Studenten nicht bis zum Schluss an der Prüfung sitzen, um alle möglichen Fehler auszubügeln. Sei also nicht verunsichert.
Wenn du die letzte Frage beantwortet hast, nutze die restliche Zeit um zu schauen, dass du auch keine Frage ausgelassen hast und auch jede Frage richtig verstanden hast. Vermeide es, Antworten zu ändern, wenn du nicht absolut sicher bist, dass du einen Fehler gemacht hast, denn meistens ist die erste Antwort, die du gibst, auch die richtige.
Vergiss nicht, deinen Vor- und Nachnamen auf die Antwortzettel zu schreiben.
Und nun viel Erfolg bei den Prüfungen!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Brainwriting ist das effektivere Brainstorming!
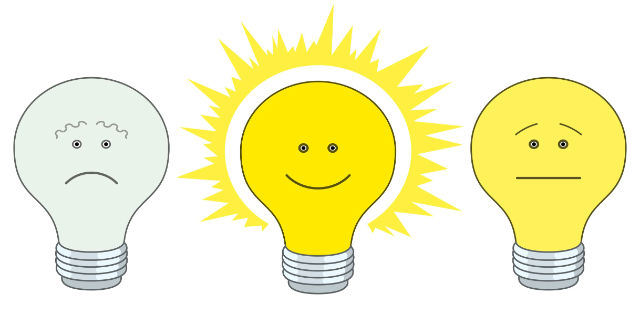 |

Wenn es darum geht, als Gruppe neue Ideen zu generieren, fällt einem meistens als erstes die klassische Brainstorming-Methode ein: Die Gruppenmitglieder sprechen einfach jeden Gedanken aus, egal wie nutzlos dieser zunächst zu sein scheint. Irgendwann -so die Hoffnung- wird schon “der geniale Einfall” dabei sein. Aber ist Gruppen-Brainstorming tatsächlich die effektivste Methode, sinnvolle und originelle Ideen zu entwickeln? Nicht unbedingt!
Von: BrainEffect-Team, 08. Mai 2010
Lernforscher haben in zahlreichen Studien Brainstorm-Gruppen untersucht und festgestellt, dass Studienteilnehmer, die alleine gearbeitet haben, bessere Ergebnisse erzielten als diejenigen, die in der Gruppe Ideen gesammelt haben – sowohl betreffend der Menge als auch der Qualität der Ideen. Dafür gibt es drei Gründe:
1. Furcht vor negativem Feedback
In der Gruppe fällt es nicht immer leicht, die wildesten Ideen auszusprechen, auch wenn gerade solche Ideen oftmals diejenigen sind, die das grösste Potential haben. Man möchte in der Gruppe nicht ausgelacht werden und behält daher die Idee lieber für sich.
2. Kampf der Persönlichkeiten
Brainstorming-Runden können schnell unproduktiv und gar ungemütlich werden, nämlich dann, wenn besonders durchsetzungsstarke Typen sich ins Rampenlicht der Gruppe stellen und die Runde nicht moderieren sondern beherrschen. Oft sind sie dazu noch stur. Passive und schüchterne Teilnehmer kommen so gar nicht zu Wort. Der kreative “Flow”, den man sich durch das Brainstorming erhofft hat, kommt gar nicht erst auf.
3. Ideen-Stau
Beim klassischen Brainstorming kann immer nur ein Teilnehmer reden. Die Folge: Während ein Brainstormer seine Idee vorstellt, fangen die anderen an, ihre Ideen unbewusst anzupassen, zu verändern oder sie vergessen sie sogar. Denn unserem Gehirn fällt es schwer, mehreren Ideen gleichzeitig aufmerksam zu folgen. Insgesamt werden dadurch also weniger Ideen produziert als wenn man alleine Ideen sammelt.
Wenn es also stimmt, dass das klassische Brainstorming alleine besser funktioniert als in der Gruppe, sollten wir das Ideensammeln in der Gruppe ganz aufgeben? Oder gibt es einen Weg, die offensichtlichen Vorteile der Gruppendynamik zu nutzen, während man die soeben genannten Nachteile vermeidet?
An dieser Stelle setzt das sogennante Brainwriting an. Denn anders als beim Brainstorming denkt und schreibt beim Brainwriting jeder Teilnehmer selbst, keinerlei verbale Kommunikation findet in der Ideenfindungsphase statt. Konkret funktioniert das Brainwriting so: Die Brainwriting-Teilnehmer sitzen gemeinsam an einem Tisch und jeder bekommt ein Blatt Papier. Oben auf diesem Blatt steht bei jedem Teilnehmer die selbe Fragestellung bzw. Problematik. Der Brainwriting-Moderator gibt nun jedem Teilnehmer 3 Minuten Zeit jeweils 3 Ideen auf das Blatt Papier zu schreiben. Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die Blätter zu der jeweils links sitzenden Person weitergegeben. Jetzt beginnt eine neue Brainwriting-Runde. Jeder schreibt 3 neue Ideen unter die des Nachbarn, welche als Inspiration genutzt oder einfach ignoriert werden können. Das Ganze kann immer so weiter gehen bis die Brainwriting-Teilnehmer denken, dass sie genug Ideen gesammelt haben. Nach der Ideenfindungsphase werden alle Ideen vorgelesen, besprochen und vom Brainwriting-Moderator zusammengefasst.
Die Vorteile vom Brainwriting gegenüber dem klassischen Brainstorming sind:
- Beim Brainwriting werden viel mehr Ideen produziert. Zur Veranschaulichung: Mit der Brainwriting-Methode kann man bei 6 Teilnehmern und 3 Ideen alle 3 Minuten ganze 90 Ideen in 15 Minuten generieren.
- Ideen werden beim Brainwriting sofort festgehalten. Sie gehen nicht verloren während andere Teilnehmer ihre Ideen vorstellen.
- Alle Teilnehmer kommen beim Brainwriting zu Wort und alle Beiträge bekommen die selben Chancen.
- Die Ideen können anonym vorgestellt werden, daher kann sich beim Brainwriting jeder trauen, auch mal verrückte Ideen einzubringen.
- Die Zeitbegrenzung beim Brainwriting gibt den Teilnehmern einen leichten Druck, Ideen zu liefern und führt daher zu einer Produktivitätssteigerung.
Wenn es also darum geht, dir ein Hausarbeits-, oder Abschlussthema auszudenken, setze dich doch mit Kommillitonen zusammen, die vor der selben Frage stehen, und starte mit ihnen eine Brainwriting-Sitzung.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Brainwriting-Pool und 6-3-5 Methode
 |

Brainstorming kennt jeder und es ist aus dem gemeinschaftlich-kreativen Arbeiten nicht wegzudenken. Weniger bekannt ist das Brainwriting, das hier vorgestellt wird.
Von: Sebastian
Brainwriting unterscheidet sich vom klassischen Brainstorming darin, dass die Ideen – wie der Name schon sagt – schriftlich festgehalten werden. Anschliessend erhält jeder Teilnehmer die Chance, alle anderen Ideen zu lesen und diese -weiterhin schriftlich- zu ergänzen, zu verändern oder sich von ihnen zu neuen eigenen Ideen inspirieren zu lassen. Erst nachdem jeder Teilnehmer der Brainwriting-Runde Zeit hatte, über jede Original-Idee nachzudenken, wird die mündliche Diskussion gestartet.
Die Vorteile des Brainwriting: jeder hat dieselbe „Redezeit“, deshalb kommen beim Brainwriting auch die stilleren Teilnehmer gleichermassen zu Wort. Entstehen zwei gute Ideen gleichzeitig, wird nicht die eine durch die andere totgeredet. Bei manchen Brainwriting-Methoden bleiben die Urheber anonym, sodass kein Urheber bevorzugt oder benachteiligt wird.
Besonders einfach zu handhaben ist die Brainwriting-Methode 6-3-5, da ihre Regeln für eine klare Struktur sorgen: 6 Personen haben jeweils für 3 Ideen 5 Minuten Zeit. Konkret heisst das: Ihr braucht pro Person ein Blatt, am besten mit einer vorbereiteten Tabelle von 6 Zeilen und 3 Spalten. Nun hat jeder 5 Minuten Zeit, um auf seinem Blatt 3 Ideen zu notieren. Danach werden die Zettel kreisförmig reihum zum Nachbarn gereicht. Dieser schreibt nun unter jede Idee, was ihm dazu einfällt. Nach weiteren 5 Minuten gehen die Blätter weiter zum Nächsten usw. Nach 30 Minuten Brainwriting haben alle Teilnehmer jede Idee gesehen und ergänzt. Natürlich funktioniert diese Brainwriting-Methode auch mit anderen Teilnehmerzahlen.
Nicht ganz so strukturiert, dafür anonym ist der Brainwriting-Pool. Dabei werden Ideen aufgeschrieben und dann in der Tischmitte – dem Pool – abgelegt. Wem gerade nichts eigenes einfällt, nimmt sich einen Zettel aus dem Pool; fällt ihm dazu etwas ein, schreibt er es darunter und legt das Blatt zurück. Das Brainwriting wird fortgesetzt, bis niemand mehr irgendwo etwas anmerken möchte. Um die Anonymität weitgehend zu gewährleisten, helfen gleichartige Stifte und Druckschrift.
Selbstverständlich sind abwertende Kommentare tabu! Nur so entwickelt Brainwriting seine Stärke: eine Lösungsfindung, an der wirklich jeder in der Runde maßgeblich mitgewirkt hat.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Brain Food - sich richtig ernähren um erfolgreich zu lernen
 |

„Ein voller Bauch studiert nicht gern!“
Viel Wahres steckt hinter dieser Binsenweisheit. Der Körper konzentriert sich nach dem Essen vor allem auf die Verdauung und fährt alle anderen Prozesse, wie zum Beispiel die Gehirnaktivität, herunter. Das bedeutet für dich: vor dem Lernen oder vor einer Klausur solltest du nicht zu viel essen!
Von: Max
Mindestens genauso wichtig wie das WANN ist das WAS. Bestimmte Lebensmittel - Brain Food - helfen dir zu einem effektiveren Studium. Sie wirken sich dabei ganz unterschiedlich auf deinen Körper aus. Einige liefern Grundbausteine für deinen Stoffwechsel und Zellaufbau. Andere fördern die Durchblutung des Gehirns und unterstützen somit deine Konzentrations- und Merkfähigkeit. Alle zusammen schaffen die Voraussetzung für optimale Lernerfolge.
Hier ein paar Brain Food - Tipps:
Wasser:
Fast ¾ des Gehirns bestehen aus Wasser, was deutlich macht, wie enorm wichtig H2O für die Funktionsfähigkeit des Gehirns ist. Wenn es nun zu Dehydration im Organismus kommt, schüttet das Gehirn das Hormon Cortisol aus, welches die Dendriten schrumpfen lässt. Diese Verästelungen speichern Informationen. Ein Schrumpfen dieser Dendriten führt also zu einer Verschlechterung der Gehirntätigkeit. Trink also mindestens 8 Gläser Wasser am Tag, um dein Gehirn aktiv und geschmeidig zu halten.
S4S Brain Food - Note: 9/10.
Fisch:
Ganz egal, ob Lachs, Forelle, Hering, Heilbutt oder Zander, jeder Kaltwasserfisch ist die ideale Quelle für die Omega-3-Fettsäure, dem Basisbestandteil unseres Gehirns, unseres Nervengewebes und der Netzhaut. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der Konsum von Omega-3-Fettsäuren die Lern-, Problemlösungs- und Erinnerungsfähigkeit unterstützt. Das liegt vor allem daran, dass die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen durch Omega-3-Fettsäuren verstärkt wird.
S4S Brain Food - Note: 8/10.
Rotes Fleisch und Leber - Eisenhaltige Nahrungsmittel:
In verschiedenen Studien wurde Eisenmangel als eine der Hauptursachen für Konzentrationsschwäche, schwache Merkfähigkeit und abnehmende Intelligenz erkannt. Eisen ist von entscheidender Bedeutung für die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff, den es benötigt um leistungsfähig zu bleiben. Rotes Fleisch und Leber sind optimale Lieferanten.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Früchte:
Zitrusfrüchte und Farbstarke Früchte wirken sich positiv auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns aus. Vor allem Avocados können die Durchblutung des Gehirns verbessern. Das liegt besonders am hohen Gehalt von einfach-ungesättigten Fetten. Andere Früchte, die einen positiven Einfluss auf unser Gehirn haben und helfen Informationen schneller abzurufen, sind Pflaumen, Ananas, Orangen, Äpfel, Kiwis, Pfirsiche, Trauben, Kirschen, Zuckermelonen und Wassermelonen.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Beeren:
Bekannt für ihren positiven Einfluss auf motorische Fähigkeiten und Lernkapazität sind die Heidelbeeren. Erdbeeren sind reich an Fisetin, einem Flavenoid, das die Erinnerungsfähigkeit positiv beeinflusst. Holunderbeeren, Himbeeren und schwarze Johannisbeeren wirken sich positiv auf deine Gehirnleistung aus, weil ihre antioxidierenden Eigenschaften die Oxidation von wichtigen Molekülen verhindern. Mit vielen Beeren kannst du deshalb besser lernen.
S4S Brain Food - Note: 8/10.
Eier:
Eier sind reich an Vitamin B und Lecithin und ein guter Lieferant von gesättigten Fettsäuren. Das Eigelb hat ausserdem einen hohen Anteil an Cholin, einem wesentlichen Bestandteil der Gehirnzellen, und unterstützt somit das Erinnerungsvermögen.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Milchprodukte - Kalziumreiche Nahrungsmittel:
Lebensmittel wie Joghurt, Milch und Käse sind reich an Kalzium und verbessern die Funktion der
Nerven Vor allem Joghurt enthält Aminosäuren und Tyrosine, die für die Produktion von Neurotransmittern verantwortlich sind. Die biochemischen Stoffe übertragen elektrische Reize von einer Zelle zur anderen und helfen die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit zu steigern.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Soja:
Aus ganzen, biologisch angebauten Sojabohnen hergestellte Nahrungsmittel, wie Sojamilch oder Tofu, sind reich an Lecithin und Cholin. Lezethin verhindert die Ablagerung von Kalk in den Gefäßen des Gehirns. Cholin wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Gehirns aus und verlangsamt zusätzlich den normalen Erinnerungsverlust.
S4S Brain Food - Note: 6/10.
Blattgemüse und Kreuzblütler:
Blumenkohl, Rosenkohl, Senfblätter, Wasserkresse und Spinat, Kohl, Rüben, Kohlrabi und Broccoli unterstützen kognitive Funktionen. Andere Gemüse, die dein Gehirn in Schwung bringen sind Zwiebeln, Spargel, Sprotten, Kopfsalat, Karotten und Pilze.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Schokolade:
Sie schmeckt nicht nur gut, sie wirkt sich auch positiv auf deine Stimmung aus. Natürliche Inhaltsstoffe aus der Schokolade regen die Endorphinproduktion an und verbessern deine Reaktionszeit. Dunkle Schokolade ist reich an Flavanolen, welche die Durchblutung des Gehirns steigern und somit die kognitiven Fähigkeiten steigern. Schokolade ist quasi passives Gehirntraining.
S4S Brain Food - Note: 6/10.
Nüsse:
Da sie reich sind an Vitamin E und B6, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie Antioxidantien haben Nüsse einen starken Einfluss sowohl auf deine Stimmung als auch auf deine Gehirntätigkeit. Egal, ob Haselnüsse, Walnüsse, Erdnüsse oder Mandeln, sie alle helfen deinem Gehirn auf die Sprünge. Nicht umsonst machen sie einen Hauptbestandteil des Studentenfutters aus.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Kerne:
Reich an gedächtnisfördernden Omega-3-Fettsäuren sind Leinsamenkerne. Geröstete Kürbiskerne beinhalten entspannendes Tryptophan und getrocknete Sonnenblumenkerne versorgen das Gehirn mit Thiaminen, einer Form des Vitamin B, welches das Gedächtnis und die kognitiven Fähigkeiten stärkt.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Bohnen und Hülsenfrüchte:
Der Treibstoff des Gehirns ist die Glucose. Da aber das Gehirn keine eigene Glucose produzieren kann, musst du dafür sorgen, dass eine konstante Zufuhr gewährleistet ist, wenn du ein optimales Studium leisten willst. Hülsenfrüchte und Bohnen sind die idealen Lieferanten. Reich an Antioxidantien, Eisen und Nährstoffen helfen sie den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Dabei ist es egal, ob du lieber Linsen, Erbsen und andere Hülsenfrüchte oder weisse, rote oder Kidneybohnen magst.
S4S Brain Food - Note: 6/10.
Kräuter:
Ginko gehört zu den bekanntesten Kräutern, welche die Konzentration und Merkfähigkeit fördern und oft bei Lernproblemen verwendet werden. Es weitet die Blutgefässe und verbessert somit die Durchblutung sowie die Versorgung mit Sauerstoff. Ebenso zerstört es Freie Radikale, die schädlich für die Gehirnzellen sind. Eine ähnlich effektive, aber weniger bekannte Pflanze ist Rosenwurz (Rhodiola Rosea). Sie steigert die Aufnahmefähigkeit und die Konzentration.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Tee:
Ein wahres Wundermittel für deinen Körper und dein Gehirn ist Tee. Er kann sowohl beruhigend als auch aufputschend wirken. Das in den meisten Teesorten enthaltene Katechin hat eine entzündungshemmende Wirkung und beugt ebenso der Verkalkung der Gefässe vor. Grüner Tee wirkt entspannend auf den Körper, während das in schwarzem Tee enthaltene Teein anregend wirkt. Es ist dem im Kaffe enthaltenen Coffein in der Wirkung ähnlich, wird aber langsamer vom Körper aufgenommen und auch abgebaut. Die Wirkung von Teein hält also länger an.
S4S Brain Food - Note: 7/10.
Organische Pflanzenöle:
Pflanzenöle enthalten viele essentielle Fettsäuren, die sich positiv auf dein Gehirn und dein Erinnerungsvermögen auswirken. Ihr Gehalt in Oliven-, Wallnuss- und Leinsamöl ist besonders hoch.
S4S Brain Food - Note: 6/10.
Die genannten Lebensmittel zeigen die vielfältigen Inhaltsstoffe und Auswirkungen von Nahrungsmitteln. All diese Brain Foods können sich positiv auf deine Lernleistung auswirken.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Gegen die Leere im Kopf
 |

Jeder kennt es, und jeder hasst es. Wenn man sie braucht, ist sie meist nicht verfügbar – die zündende Idee. Doch man kann sie anlocken, denn jeder verfügt über ein kreatives Potenzial, und es gibt einfache Tricks, dieses Kapital zu fördern.
Von: Arne Olerth
Der Mensch unterscheidet sich vom Computer in einem wichtigen Punkt: Er kann schöpferisch denken und handeln, er kann kreativ sein. Diese Erkenntnis führt dazu, dass Kreativität im Job immer stärker gefragt wird. Aber bereits jetzt stossen viele Menschen an die Grenzen ihrer kreativen Leistungsfähigkeit. Dabei ist es ganz einfach, seinen eigenen „Kreativschatz“ zu bergen.
Ein wesentlicher Faktor für eine ausgeprägte Kreativität ist die Ernährung. Sie beeinflusst unsere Stimmung, unsere Aktivität und unsere mentale Leistungsfähigkeit. Nach Ansicht von Ernährungsexperten haben bereits geringe Mangelzustände grosse Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns – die Konzentrationsfähigkeit sinkt, und man vergisst schneller. Sogenanntes Brainfood unterstützt unsere Gehirnleistung und schützt langfristig unsere grauen Zellen. Damit ist keine Wunderdiät gemeint und auch keine Zauberpille der pharmazeutischen Industrie. Der Brainfood-Klassiker ist das Studentenfutter: getrocknete Früchte und Nüsse. US-Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die Hirnleistung bei Schülern um 30 Prozent stieg, nachdem sie einen Monat lang in den Unterrichtspausen Nüsse und Obst anstelle von Fastfood gegessen hatten.
Damit das Gehirn Höchstleistungen vollbringen kann, benötigen die Nervenzellen einen ausgeklügelten Mix aus Makro- und Mikronährstoffen, vor allem aber Energie und Wasser. Ernährungswissenschaftler empfehlen täglich mindestens zwei Liter Flüssigkeit aufzunehmen. Das Blut dickt sonst ein, und die Sauerstoffversorgung der Gehirnzellen nimmt ab. Es besteht die Gefahr von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Wasser, ungesüsste Früchte- und Kräutertees oder Fruchtsaftschorlen sollten dabei erste Wahl vor Getränkelimonaden sein. Der Powerspender fürs Gehirn ist das Kohlenhydrat Glucose. Für die Kommunikation der Gehirnzellen untereinander benötigt der Körper bestimmte Eiweisse. Auch Fette, besonders Omega-3-Fettsäuren, sind für das Funktionieren der Zellen wichtig. Vitamin- und Mineralstoffmangel setzt die Leistungsfähigkeit des Gehirns herab. Darum sollte man reichlich Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Gemüse und Obst essen und als Fett Raps- oder Walnussöl wählen. Und: Viele kleine Mahlzeiten sind besser als wenige grosse.
Banal, aber oft vergessen: Ein gesunder und ausreichender Schlaf ist für die geistige Höchstform unabdingbar. Wer früh raus muss und regelmässig vor dem Spätfilm hängen bleibt, der sollte sich nicht über schlechte Konzentrationsfähigkeit wundern. Regelmässige körperliche Aktivität steht ebenfalls auf der To-do-Liste für Kreativität. Bewegung steigert die Durchblutung und damit die Merkfähigkeit und die Funktion des Kurzzeitgedächtnisses. Schon wenige Minuten verdoppeln die Saustoffzufuhr des Gehirns. Darüber hinaus nimmt die Vernetzung der Zellen im Gehirn zu. Und so können die Zellen besser miteinander kommunizieren – ein klares Plus für die Leistungsfähigkeit des Gehirns.
Dass bei stickigem Büromief keine Geistesblitze zünden, ist wohl jedem klar. Regelmässiges Lüften erhöht die Sauerstoffkonzentration in der Luft und damit die Möglichkeit für kreative Gedanken. Kreativität braucht ausserdem Raum. An wem das schlechte Gewissen über einen Wortbruch nagt, der kann kaum kreativ werden.
Also: Weg mit dem Seelenmüll! Alles Belastende sollte man aus dem Weg räumen, dann hat der Geist Platz für kreative Gedanken. Wer rastet, der rostet. Diese Binsenweisheit gilt nicht nur für die Gelenke und den Bizeps, auch das Gehirn muss regelmässig gefordert werden, sonst erschlafft es genauso wie der untrainierte Oberarmmuskel. Für die Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl ist regelmässiges Training des Gehirns eine der drei Grundvoraussetzungen für Kreativität. Sie listet darüber hinaus assoziatives Denken und Wissen auf. Ohne geistigen Input kann es also nur wenige kreative Momente geben. Ein jeder sollte darum den natürlichen Wissensdurst stillen, sei es durch Zeitungs- und Bücherlesen, Gespräche oder Reisen. Dass ein Spaziergang durch die geschwungenen Hügel der Toskana inspirierender sein kann als der Alltag im tristen neonerleuchteten Büro, versteht sich von selbst. Solch inspirierende Momente wollen gesucht sein!
Es gibt aber auch ganz praktische Möglichkeiten, eine Idee zu entwickeln. Oberste Prämisse: Man muss das Ziel formulieren. Ohne dieses Ziel weiss das Gehirn nicht, wonach es eigentlich suchen soll. Darüber hinaus braucht es problemspezifisches Futter, also Know-how und Hintergrundwissen rund um die Fragestellung. Am besten schreibt man also das Problem als erstes auf ein Blatt Papier, denn ohne Vorbereitung kein Gedankenblitz. Als nächstes macht man einfach gar nichts. Auch wenn es sich ungewöhnlich anhört, man sollte das Problem schlicht vergessen. Das Unterbewusstsein arbeitet jetzt. Man muss Vertrauen haben und darf nicht ungeduldig werden. Die kreative Phase braucht Zeit. Notfalls kann man durch mentale Entspannungstechniken wie autogenes Training oder Yoga weiter relaxen. Meist zündet der Gedankenblitz dann in einem völlig unerwarteten Moment. Die Lösung des Problems ergibt sich zum Beispiel auf einem Spaziergang oder beim Kneipenbesuch oder kurz vor dem Aufstehen.
Dann heisst es: Die Lösung muss sofort notiert werden. Nach der Anfangseuphorie über das gelöste Problem sollte man die Lösung noch einmal in Ruhe kritisch hinterfragen. Sollte sie nicht optimal sein, so kann man seinen kreativen Prozess erneut bemühen. Keine Zauberei – mit diesen einfachen Ansätzen sollten erfolglose Ideensuchen der Vergangenheit angehören.
Webtipps:
- www.brainfit.com
- www.kreativ-sein.de
- www.philognosie.net
- www.methode.de
- Gesundheitstipps:
Sprossen sind eine unschätzbare Quelle für Mineralien und Spuren-Elementen. Sie sind reich an Kalzium und Magnesium und enthalten Eisen, Fluor, Kalium, Kupfer, Mangan, Natrium und Zink - alles, was das kreative Hirn braucht. Und das Beste ist: Sprossen lassen sich mit wenig Aufwand selbst ziehen.
Infos unter www.gesunde-sprossen.de.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 5/2009. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
China Business-Knigge
 |

Wer im Reich der Mitte geschäftlich tätig werden möchte, sollte sich mit den gesellschaftlichen und kulturellen Bräuchen vertraut machen. Was Europäer im Geschäftsleben mit Chinesen seltsam anmutet, wurzelt tief in der Denkwelt der Chinesen und führt zurück auf Yin und Yang, Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit chinesischen Geschäftspartnern setzt das Verständnis ihrer Denk- und Arbeitsweise sowie ihres Verhaltens voraus.
Von: Jennifer Wroblewsky
Für den erfolgreichen Verlauf eines Geschäfts, ist in China vor allem die Qualität der Businesskontakte entscheidend. Vor dem Abschluss eines Geschäfts steht nämlich der Beziehungsaufbau, Guanxi genannt.
Beziehungen knüpfen Chinesen bereits während ihres Studiums – als Europäischer Geschäftsmann muss man sich dieses Vertrauen erst erarbeiten. Chinesen denken sehr stark in Beziehungsnetzen und schätzen Personen, die wiederum viele wichtige Menschen kennen. Um ein Netzwerk aufzubauen, lassen Sie sich von Kollegen, die bereits länger in China sind, wichtige Kontakte vorstellen. Aber Vorsicht: Ihre Kollegen bürgen mit ihrem Namen für Sie.
Zum ersten Treffen mit dem chinesischen Geschäftspartner empfiehlt sich für Herren ein dunkler Anzug mit Krawatte. Damen sollten ein Kostüm tragen und wenig Haut zeigen. Für beide gilt: Es sollte immer geschlossenes Schuhwerk getragen werden. Geschäftspartner werden mit einem sanften Händedruck begrüsst. Gleichzeitig wird der Kopf leicht gebeugt: Das gilt als höflich. Die Anrede enthält immer den Titel oder die Position der angesprochenen Person und den Nachnamen. Bei jedem ersten Treffen werden Visitenkarten ausgetauscht. Die Übergabe erfolgt mit beiden Händen, wobei währenddessen eine leichte Verbeugung ausgeführt wird. Auf das Kennenlernen folgt ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wo immer Sie ihrem Geschäftspartner helfen können, sollten Sie dies auch tun oder zumindest Ihre Hilfe anbieten. Im Gegenzug können auch Sie sich der Hilfe Ihres Geschäftspartners gewiss sein.
Was kommt bei Chinesen an?
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch in China. In der chinesischen Kultur spielen Geschenke eine grosse Rolle. Daher sollten Sie Ihrem Geschäftspartner zum ersten Treffen etwas mitbringen. Chinesen freuen sich über teure Pralinen oder hochwertige Bildbände. Eine Uhr verschenken Sie besser nicht, denn diese symbolisiert Vergänglichkeit.
Geschäfte werden in China mit Menschen gemacht, nicht mit Unternehmen. Stellen Sie Ihren chinesischen Geschäftspartnern nie ausschliesslich nur das Unternehmen und das Produkt vor, sondern erzählen Sie auch etwas über sich selbst. Chinesische Verhandlungspartner möchten sich einen Gesamteindruck vom Unternehmer verschaffen und herausfinden, wie die Person selbst zum Geschäftsvorhaben steht. Bemerken Ihre Geschäftspartner, dass Ihre Aussagen nicht Ihrer persönlichen Meinung entsprechen, werden Sie keinen Erfolg haben.
Höflichkeit und Freundlichkeit haben in China einen wesentlich höheren Stellenwert als in der Schweiz. Treten Sie daher immer kultiviert auf und überlassen Sie den Chinesen den Vortritt. Verlieren Sie bei Verhandlungen niemals die Geduld, werden zornig, brüllen herum oder hauen auf den Tisch. Dieses Verhalten könnte die mühsam aufgebauten Beziehungen binnen weniger Sekunden zerstören.
Keine Angst vor Stäbchen
In China wählt der Gastgeber die Speisen aus. Er ist es auch, der mit dem Essen beginnt. Sie dürfen ruhig Besteck bestellen – Ihr Geschäftspartner wird es nicht als beleidigend empfinden. Möchten Sie ihm besonderen Respekt erweisen und zu Stäbchen greifen, sollten Sie einiges beachten: Benutzen Sie diese nicht dazu, um Dinge auf dem Tisch zu verschieben, gestikulieren Sie nie mit den Stäbchen in der Hand und zeigen Sie keinesfalls mit den Stäbchen auf Ihre Geschäftspartner. Gibt es Suppe, führen Sie die Schale mit zwei Händen zum Mund. Möchten Sie nichts mehr trinken, lassen Sie Ihr volles Glas auf dem Tisch stehen. Denn Gläser werden immer nachgefüllt, sobald diese mehr als zur Hälfte ausgetrunken sind. Wenn Sie satt sind, lassen Sie auf Ihrem Teller einen Anstandshappen liegen. Lob über Essen hören Chinesen übrigens besonders gern.
Ein direktes Ja hört man in China oft, selten jedoch ein direktes Nein. Europäer sollten das Wörtchen “Nein” besser mit Sätzen wie „Das könnte schwierig werden“ oder „Ich werde es versuchen“ umschiffen. Ein wichtiger Unterschied zu Europa ist, dass der öffentliche Umgang mit Kritik in China zum Gesichtsverlust des Betroffenen führt. Daher drückt man sich am besten immer positiv aus.
Wann immer Sie unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, orientieren Sie sich an Ihren chinesischen Geschäftspartnern. Und wenn Sie mal gar nicht weiter wissen? Einfach freundlich lächeln.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 2 - 2007. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Die verfĂĽhrerische Bewerbung
 |

Zahlreich sind die Tipps und Tricks, die das Internet den Jobsuchenden zur Verfügung stellt. 'SCROGGIN-career' stellt einige vor. Ob eine Bewerbung online oder auf Papier über die gute alte Post eingereicht werden soll, hängt primär von den Wünschen des Adressaten ab. Jedoch ist zu beachten: Jede Bewerbung ist Werbung, mit der der Bewerber sich verkaufen will. Geh also wie ein Marketingspezialist vor, um den bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen.
Von: Christoph Deuel
Der erste Tipp für eine erfolgreiche Bewerbung: positiv auffallen. Bewerbungsunterlagen, die negativ aus der Menge hervorstechen, werden umgehend aussortiert. Wer nicht auffällt, wird nicht beachtet. Die Aufmerksamkeit des Adressaten kannst du auf verschiedene Art und Weise erregen, wobei provokative, besonders schrille Auftritte für akademisch zu besetzende Stellen eher zu vermeiden sind. Die AXA Winterthur meint dazu auf ihren Karriereseiten: «Ihr Begleitbrief ist das Erste, was der HR Manager liest. Übersichtlichkeit ist wichtiger als Originalität. Mit dem Schlusssatz muss der HR Manager überzeugt sein, Sie einladen zu wollen.» Verschick also genau das, was der Leser erwartet. Es ist von grossem Vorteil, den Adressaten genau zu studieren, mit sämtlichen Daten, die du vor allem im Internet findest. Wenn du weisst, was den Empfänger anspricht, kannst du exakt darauf eingehen und hast die besten Chancen, den Inhalt deiner Bewerbung an die Personalverantwortlichen zu bringen.
Bei den Mitteln kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. In einer gedruckten Bewerbung kannst du aus dem Vollen schöpfen. Im ersten Schritt wird auf das Äussere deines Dossiers geachtet. Verwende zum Beispiel ein Format, das einen Hauch grösser ist als das standardisierte DIN A4 und hebe damit deine Unterlagen bereits im Stapel von deiner Konkurrenz ab. Achte des Weiteren auf die Wahl des Materials für Papier und Umschlag. Denn die Vorselektion der eingereichten Bewerbungsunterlagen beschränkt sich nicht nur auf den Inhalt, sondern auch der subjektive Eindruck, der von allen Sinnen herrührt, zählt.
Inhaltlich überzeugen
Dein Anschreiben kann durch unnötige Fehler und einen flüchtigen Schreibstil schnell zur Disqualifikation beitragen. Aufgabe ist es, deinem Gegenüber in wenigen Sätzen zu erläutern, warum sich das weitere Studium deiner Akten lohnt. Es muss klar ersichtlich sein, dass es sich um ein Bewerbungsschreiben handelt, welche Stelle du suchst und warum du dich am besten dafür eignest. Ein Jobprofil deiner Wunschposition hilft, die perfekten Voraussetzungen zu ermitteln, damit du erwähnen kannst, dass du die entsprechenden Kriterien erfüllst. Du besitzt genügend Fähigkeiten, um viele der Bedingungen zu erfüllen, ohne übertreiben zu müssen. Bleib dabei immer bei der Wahrheit. Wirst du beim Lügen ertappt, wäre das äusserst peinlich und der weiteren Zusammenarbeit nicht gerade förderlich.
Stichwort Online-Bewerbung
Online-Bewerbungen boomen stark, aber du solltest einige Besonderheiten beachten: Schreibe persönlich an die zuständige Person. Erfrage dafür im Voraus deren Adresse und vermeide allgemeine Destinationen wie info@firma.ch. Viele User drucken Online-Bewerbungen aus, so dass sie als üblicher Briefverkehr angesehen werden. Die Verwendung von emotionalen Zeichengebilden («Emoticons») sind bei einer Bewerbung ebenso tabu wie im Internet gebräuchliche Abkürzungen wie zum Beispiel «MfG» («Mit freundlichen Grüssen»).
In den vergangenen zwei Jahren haben Online-Bewerbungen stark zugenommen – und damit auch die Flut an Bewerbungsunterlagen. Denn digital kann man viel schneller und systematischer auf Stellenangebote reagieren. Personalabteilungen – wie etwa bei der Credit Suisse – haben sich darauf eingestellt und selektieren Bewerber durch ein «Online Assessment » vor. Erich Grimm, Leiter des Recruiting Uetlihof bei der Credit Suisse, erklärt im e-magazin des Unternehmens: «Das Online Assessment unterstützt uns massgebend in der Platzierung der Kandidaten und kommt auch der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie entgegen.» (aus: In Focus, dem Online-Magazin der Credit Suisse)
Vergewissere dich vor dem Versand, ob der Adressat eine Online-Bewerbung wünscht oder lieber die Papierbewerbung vorzieht. Wählst du die Internet-Variante, gestalte deine Mail so persönlich wie möglich. Erwecke nicht den Eindruck, die gleiche E-Mail zehnmal versendet zu haben, und spare nicht an Informationen über deine Person. Je mehr der Personalverantwortliche über dich erfährt, desto plastischer wird seine Vorstellung von dir. Sei dir bewusst, dass dein Dossier am Computer wesentlich schneller bearbeitet und erfasst wird. Reagiere darauf, indem du vermehrt auf Schlagwörter setzt. Verwende korrekte Bezeichnungen und lasse keine wesentlichen Kriterien einer Bewerbung aus. Inzwischen ist es üblich, Bewerbungsmasken zur Verfügung zu stellen. Mit einem einheitlichen Layout und gleichartigen Daten können die Kandidaten besser und systematischer verglichen werden. Profitiere von der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit dieser Angebote. Vergiss aber trotzdem nicht, dich in deiner Eigenwerbung als Individuum zu präsentieren.
Soft Skills
Soft Skills sind persönliche Eigenschaften wie Team- und Kommunikationsfähigkeit, Führungsqualitäten oder rhetorisches Geschick. Häufig werden sie auch mit dem Wort Sozialkompetenz umschrieben. Mit Soft Skills kannst du in deiner Bewerbung sehr viel gewinnen und dich aus der Masse abheben. Damit du dich hinsichtlich deiner sozialen Kompetenzen gut verkaufen kannst, ist entscheidend, dass du schon während des Studiums Erfahrungen sammelst und dich auf verschiedenen Ebenen weiterbildest. Die meisten Fähigkeiten können erlernt werden, indem du dich den Herausforderungen in der Praxis stellst. Überaus problematisch ist es jedoch, Möglichkeiten zu finden, Soft Skills systematisch zu erlernen. Erfahrung spielt also eine übergeordnete Rolle, denn nur in der Praxis kannst du Sozialkompetenz lernen. Welche Faktoren für deine gewünschten Arbeitgeber eine Rolle spielen, entnimmst du in der Regel den Stellenausschreibungen. Musst du zum Beispiel im Job deine Meinung äussern und viel diskutieren? Dies erlernst du zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft in einer Partei.
Vorstellungsgespräch
Wirst du zum persönlichen Gespräch eingeladen, bereite dich gut darauf vor. Um selbstbewusst auftreten zu können und deine Antworten im Nachhinein nicht zu bereuen, bereite dich auf die routinemässig gestellten Fragen vor. Diese findest du zum Beispiel an vielen Stellen im Internet. So überzeugst du dich auch selbst von deiner Eignung und wirst dir bewusst, welche beruflichen Ziele du anstrebst. Du wirst sicherer, was deine eigenen Vorstellungen anbelangt, kannst selbstbewusster auftreten und verstärkt auf dein Gegenüber eingehen. Überzeuge bei deinem Auftritt mit deinen Soft Skills – er verrät sehr viel über deine sozialen Kompetenzen, deine Glaubwürdigkeit und dein Selbstvertrauen. Wundere dich nicht, wenn der Personaler dich auf die Gründung einer Familie anspricht. Solch eine Entscheidung betrifft deine Vorgesetzten in nicht zu unterschätzendem Mass. Denn wirst du sesshaft, kann davon ausgegangen werden, dass du eine konstante Arbeitskraft einbringst. Deine Risikobereitschaft sinkt, und emotionale Stabilität ist eher anzunehmen. Wenn du noch gar nicht über das Thema Familie nachgedacht hast, besteht die Möglichkeit, bei der Frage nach deinen Planungen deine Konstanz ins Gespräch einfliessen zu lassen.
Wenn du stets offen bist gegenüber neuen Herausforderungen, wenn du während des Studiums Praktika absolvierst und keine Gelegenheit auslässt, dich weiterzubilden – sei es durch einen Auslandaufenthalt, die Hingabe für ein Fach oder den Einsatz im Team – werden dir kaum Hindernisse im Weg stehen, eine ansprechende, auf dich zugeschnittene Stelle zu finden.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Der perfekte Vortrag
 |

Richtig aufgebaut kann ein Vortrag zum Highlight jeder Veranstaltung werden. Der Vortrag kann die Zuhörer ergreifen, überzeugen, mitreissen. Er ist die beste Gelegenheit, etwas mitzuteilen, denn die anderen sind nur Zuhörer. Das sollte man nutzen.
Von: Christoph Berger
Vorbereitung
Damit du in einem Vortrag keine wichtigen Punkte vergisst, ist es hilfreich, dir in der Vorbereitung erst einmal eine Liste mit sämtlichen Gedanken zu machen, die erwähnt werden sollen. Fasse die Gedanken unter einzelnen Stichworten zusammen und bringe sie später in eine logische Reihenfolge. Nun hast du das Gerüst des Vortrags. Sammele dann alle Informationen zu den einzelnen Punkten. Damit das Gerüst einen Vortragscharakter erhält, solltest du dir die einzelnen Gedanken vorsagen und aufnehmen. So erhältst du sofort ein Gefühl für das gesprochene Wort und kommst auf Formulierungen, die deinen Vortrag lebendig machen. Das Band kannst du dann abschreiben.
|
Sämtliche Gedanken nur schriftlich festzuhalten, macht den Vortrag möglicherweise etwas steif. Sind die Stichworte auf Karteikarten geschrieben, kannst du diese in eine andere Reihenfolge bringen, um vielleicht auf einen noch besseren Aufbau zu kommen. Der Rhetorikexperte Holger Münzer empfiehlt für den eigentlichen Vortrag ein DIN A5-Papierformat, jeweils einen Zettel für jede Station. Die Grösse ist handlich und lässt sich auch ohne Rednerpult gut halten. Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 3 und wurde zur Verfügung gestellt von karriereführer hochschulen Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Der perfekte Vortrag - Checkliste und PraxisĂĽbungen
 |

Um dich gut auf einen Vortrag vorzubereiten, zeigen wir dir folgend drei praktische Übungen und eine nützliche Checkliste.
Viel Erfolg!
Von: Christoph Berger
- Checkliste
- Redeinhalte sammeln und in eine vernünftige Reihenfolge bringen.
- Den Inhalt vor sich hinsagen und aufnehmen.
- Einen Einstieg mit Witz finden, zum Beispiel eine Anekdote.
- Den Redekern einkreisen und langsam zum Höhepunkt kommen.
- Die Argumente immer wichtiger werden lassen, Aufbau einer Dramaturgie.
- Die Konsequenz aller Argumente ist der Höhepunkt.
- Im Schlussteil die Rede nochmals zusammenfassen.
- Das Publikum zum Handeln auffordern.
- Authentizität ist neben dem Inhalt das A und O des Vortrags.
- Technische Hilfsmittel nur einsetzen, wenn sie das Gesagte ergänzen und den Inhalt verständlicher machen.
Quellen: «Handbuch der Rhetorik» von Holger Münzer; «Wie halte ich einen Vortrag» von Martin Gruber und Bin Hu
Praxisübungen
Übung 1: Der Redner erhält während des Sprechens einen Zettel mit einer ihm unbekannten, aber überraschenden Information. Er soll weiterreden, ohne sich etwas anmerken zu lassen.
Übung 2: Der Redner erhält eine Karte mit einer Anweisung, die er ausführen soll, ohne von ihr zu sprechen. Währenddessen soll er mit seiner vorherigen Rede weiterfahren.
Übung 3: Ein Redner muss spontan zu einem frei gewählten Begriff einen dreiminütigen Vortrag halten.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 3 - 2008 und wurde zur Verfügung gestellt von karriereführer hochschulen Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben


 Wenn Du eine andere Person auf www.scroggin.info einlädst, weden Dir "150" Punkte auf Deinem Punktekonto gutgeschrieben!
Wenn Du eine andere Person auf www.scroggin.info einlädst, weden Dir "150" Punkte auf Deinem Punktekonto gutgeschrieben!