Studium
Laptops sind keine ideale Lernhilfe

Handschriftliche Notizen fördern Verständnis eher
Princeton (pte011/25.04.2014/13:33) - Für immer mehr Studenten ist das Notebook ein Lernbegleiter, auf dem sie auch ihre Notizen währen Vorlesungen machen. Doch das ist einer aktuellen Studie zufolge gar nicht so gut. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Laptops auch bei korrekter Nutzung - also nicht zum Einkaufen auf Amazon während des Unterrichts - dennoch die akademische Leistung schmälern können", so Pam Mueller, Psychologin an der Princeton University http://princeton.edu . Um Konzepte wirklich zu begreifen und langfristig zu behalten, ist es immer noch besser, sie wirklich zu Papier zu bringen.
Wissen gehört auf Papier
Mobile Computer halten immer stärker in Hörsälen Einzug, was bisher vor allem aufgrund der potenziellen Ablenkung - durch Spiele, Shopping oder überschwänglichen Online-Medienkonsum - auf Kritik gestoßen ist. Doch die in Psychological Science http://pss.sagepub.com veröffentlichte Studie zeigt ein viel grundlegenderes Problem. Digitale Notizen scheinen nicht das ideale Mittel, wenn es darum geht, wirklich inhaltliche Konzepte zu verstehen, statt nur einfach Fakten zu behalten. Das hat ein Experiment mit 65 Studenten gezeigt, die sich Notizen zu ausgewählten TED Talks http://ted.com/talks entweder auf einem Laptop oder auf einem Notizblock machen durften.
Nach den Vorträgen, die nicht unbedingt alltägliche Informationen enthalten, mussten die Probanden Ablenkungen über sich ergehen lassen, darunter eine schwierige Gedächtnisübung. 30 Minuten nach dem eigentlichen Vortrag mussten die Studenten dann Fragen zum jeweiligen TED Talk beantworten. Ging es einfach nur um Fakten, war es egal, wie die Probanden mitgeschrieben hatten. Bei konzeptionellen Fragen ("Wie unterschieden sich Japan und Schweden in ihrem Zugang zu Gleichberechtigung in der Gesellschaft?") schnitten die Laptop-Nutzer hingegen deutlich schlechter ab.
Häufig Sinnloser Wortlaut
Die digitalen Notizen waren umfangreicher und haben Vorträge eher wörtlich wiedergegeben. Ersteres scheint zwar von Vorteil, Letzteres dagegen hinderlich für den Lernerfolg. Die Forscher vermuten, dass handschriftlich Mitschreibende Information direkt vorverarbeiten und daher Wichtigeres notieren. Daher kam etwas überraschend, dass Notebook-Nutzer auch dann merklich schlechter abschnitten, wenn sie explizit ermuntert wurden, wörtliches Mitschreiben zu unterlassen. Bei Tests eine Woche nach dem Vortrag hatten Studenten mit Notizen auf Papier erneut die Nase vorn. Wieder zeigte sich, dass wörtliche Mitschriften konzeptionellem Verständnis nicht dienlich scheinen.
"Ich glaube nicht, dass wir Menschen in Massen dazu bekommen, zum Notizblock zurückzukehren", sagt Mueller. Doch gibt es einige neue Stylus-Technologien, die vielleicht eher einen sinnvollen Zugang zu digitalen gespeicherten Notizen ermöglichen. Denn solche Geräte hätten auch den Vorteil "gezwungen zu sein, eingehende Information zu verarbeiten, statt sie nur gedankenlos aufzuschreiben". Jedenfalls sollten sich die Menschen bewusst vor Augen führen, wie sie Notizen machen - sowohl mit Blick auf das Medium als auch die Strategie.
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Spartipps von Studenten für Studenten
Ich nehme mein Essen immer von zu Hause mit, so kann ich viel Geld sparen, indem ich es nicht für das Mensaessen ausgebe.
(Selina, 27 Jahre, Uni Zürich Irchel)
Verschiedene Angebote vergleichen und entscheiden, welches Angebot das passende und billigere ist. Einkaufszettel verwenden, dies verleitet weniger Sachen zu kaufen, die man gar nicht benötigt.
(Nina, 21 Jahre, PH Rorschach)
Ich achte bei Lebensmitteln sehr darauf, dass ich günstige Produkte einkaufe. z.B.: Aldi, Migros Budget
(Diego, 25 Jahre, Uni Bern)
Besonders wichtig finde ich, dass man sich immer fragt, ob man etwas wirklich braucht
und dass man auch mal verzichten kann.
(Sindy, 22 Jahre, Uni Luzern)
Weniger Kaffee trinken und weniger Bier saufen ;-)
(Christopher, 28 Jahre , Zürich ETH)
Es gibt in vielen Geschäften Studentenrabatte, durch diese kann man sehr viel Geld sparen.
(Michael, 22 Jahre, HSG)
Den Alkohol nicht im Ausgang konsumieren, sondern vortrinken, das ist viel günstiger.
(Raphael, 22 Jahre, Uni Fribourg)
Thema für die nächste Ausgabe:
Was ist deine Meinung? Sollte man nach dem Bachelor gleich weiterstudieren oder zuerst noch ein Praktikum absolvieren ?
Schreibe uns an redaktion@scroggin.info
|
|
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
USA: Bachelor treibt Studenten in Schuldenfalle
 |
94 Prozent borgen sich Geld für Ausbildung aus - Doppelbelastung droht
Ada (pte002/14.05.2012/06:05) - Aktuellen Angaben von US-Behörden steht derzeit über eine Mrd. Dollar an Studentendarlehen aus. Unter drückenden Schulden leiden nicht mehr nur Studienabbrecher oder Doktoranden, die die Kosten für ihre jahrelange Ausbildung zurückzahlen müssen. Heute borgt sich einem Bericht der New York Times nach fast jeder, der einen Bachelor anstrebt, Geld aus.
Elite-Studenten haben es leichter
Einer aktuellen Analyse der Zeitung nach leihen sich 94 Prozent der Studenten, die mit einem Bachelor abschließen, Geld für ihre Ausbildung. Grundlage für diese Erhebung sind die neuesten Daten des U.S. Department of Education http://ed.gov . Zum Vergleich: 1993 waren es nur 45 Prozent. Die Darlehen stammen von der Regierung, privaten Geldgebern und Verwandten.
Bei allen Darlehensnehmern lag die Verschuldung 2011 bei 23.300 Dollar. Zehn Prozent hatten mehr als 54.000 Dollar Schulden, drei Prozent mehr als 100.000, wie die Federal Reserve Bank of New York http://newyorkfed.org erhoben hat. Die durchschnittliche Verschuldung nach einem Bachelor-Abschluss beträgt von weniger als 10.000 Dollar, bei Elite-Unis wie Priceton und Williams College bis zu fast 50.000 Dollar an Privatuniversitäten mit weniger wohlhabenden Studenten und weniger finanzieller Unterstützung.
Ohio besonders stark betroffen
Die Studenten an der Ohio Northern University http://onu.edu , die gerade mit einem Bachelor abgeschlossen haben, gehören zu den am höchsten verschuldeten Amerikas. Die Studienabgänger der mehr als 200 Colleges und Universtitäten des Bundesstaates Ohio sind jene, die landesweit am stärksten verschuldet sind.
Auch Kelsey Griffith hat vor kurzem ihr Studium an der Ohio Northern University abgeschlossen. Um ihre Studentendarlehen über 120.000 Dollar abzubezahlen, arbeitet sie bereits in zwei Restaurants. Bald wird sie wieder zu ihren Eltern ziehen. Die Studentin hat gewusst, dass eine Privat-Uni viel Geld kostet. Nach ihrem Abschluss wird sie im Monat Raten von über 900 Dollar zurückzahlen müssen.
|
Bild oben: pixelio.de, adel |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Viele Wege in den Beruf
 |

Als Hochschulabsolvent hast du verschiedene Möglichkeiten, nach deinem Abschluss ins Berufsleben einzusteigen. SCROGGIN-career hat mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, die dir wichtige Informationen zum Berufseinstieg geben, und stellt fünf Trainee-Programme vor.
Von: Stefan Bischof
Die klassischen Einstiegsmöglichkeiten für Studierende und Absolventen bei Unternehmen sind das Praktikum, der Direkteinstieg und das Trainee-Programm. Darüber hinaus gibt es aber einen weiteren Weg, in einem Unternehmen Fuss zu fassen: über die Erarbeitung einer Bachelor- beziehungsweise Masterarbeit. Bei der Swisscom AG beispielsweise können Studierende konkrete Themenvorschläge in Form eines „Proposal Paper“ einreichen. Ist das Thema für das Unternehmen von Interesse, stehen die Chancen auf eine Zusammenarbeit gut. Der Studierende ist nicht bei der Swisscom AG angestellt, aber gemäss Mania Hodler, Verantwortliche für das University Marketing bei der Swisscom AG, besteht die Möglichkeit, dass sich aus Bachelor- oder Masterarbeiten auch Festanstellungen ergeben können.
Erste Praxiserfahrung sammeln
Wer sich ein Unternehmen erst einmal anschauen will, bevor er einen festen Vertrag unterschreibt, dem empfiehlt sich ein Praktikum. Die meisten Firmen schreiben Praktikumsplätze je nach Bedarf aus und besetzen sie mit den passenden Studierenden. So kann man schon vor Abschluss des Studiums erste Eindrücke vom Berufsleben sammeln und wertvolle Kontakte zu Mitarbeitern im Unternehmen knüpfen. Viele Arbeitgeber bieten Praktikumsstellen zwischen drei und zwölf Monaten an. Sonja Rizzardi, verantwortlich für das Hochschulmarketing der Schweizerischen Post, betont, dass ein Praktikum möglichst sechs Monate dauern sollte. „Denn für die Einarbeitungsphase in einem Grossunternehmen wie der Post muss genügend Zeit einberechnet werden, damit man die Komplexität und die Zusammenhänge des Unternehmens kennenlernen kann.“ Für Studierende macht es also durchaus Sinn, sich zu überlegen, ein Semester auszusetzen, um ein Praktikum zu absolvieren. Nicht selten verlängern Praktikanten ihren Einsatz und arbeiten anschliessend parallel zum Studium in einer Teilzeitanstellung weiter, wie Mania Hodler von der Swisscom ausführt.
Der optimale Einstieg
Nach dem Abschluss stellt sich dann die Frage, welchen Weg in Berufsleben man wählt. Ob ein Absolvent direkt oder als Trainee einsteigt, hängt von seinen Vorstellungen und Vorkenntnissen ab. Sonja Rizzardi von der Schweizerischen Post erklärt: „Ein Direkteinstieg ist empfehlenswert, wenn der Absolvent bereits genau weiss, in welcher Funktion er arbeiten möchte.“ Idealerweise besitzt er bereits in dem Bereich, in dem er starten will, erste Berufserfahrung. „Für Studierende ist es auf jeden Fall sinnvoll ist, ein Praktikum gegen Mitte oder Ende des Studiums einzuplanen“, so Sonja Rizzardi weiter. „Viele Erfolgsgeschichten zeigen, dass sich aus einem Praktikum eine Teilzeitstelle oder gar ein konkretes Stellenangebot nach Abschluss des Studiums entwickelt hat.“ Bei der Swisscom ist vor allem das Trainee-Programm sehr beliebt, da es den Teilnehmern ermöglicht, während eines Jahres in unterschiedlichen Bereichen tätig zu sein und dabei ein breites Netzwerk aufzubauen. Den für alle gleichermassen optimalen Berufseinstieg gibt es aber nicht, alle Einstiegswege haben ihre Vor- und Nachteile. Viele Unternehmen versuchen deshalb bewusst, die ganze Bandbreite abzudecken, wie Micaela Saeftel, Head of University Marketing der ABB, sagt.
Trainee-Programme
Für Absolventen, die nur geringe Arbeitserfahrungen besitzen und sich noch unsicher sind, welche Funktion sie später einmal übernehmen wollen, ist das Trainee-Programm der ideale Arbeitseinstieg. Im Folgenden ein paar Trainee-Programme:
- EF Internationale Sprachschulen: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/23487
- Go! Uni-Werbung AG: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/22
- UBS AG: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/23118&name=23118
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Was macht eigentlich einen guten Professor aus?
 |
Entschliesst man sich für ein Studium, sind ein paar entscheidende Dinge sehr schnell geklärt. Sehr oft weiss man relativ frühzeitig, an welcher Universität oder Fachhochschule man studieren möchte. Das Studienziel ist klar formuliert und die zu belegenden Vorlesungen und Seminare ergeben sich entsprechend, fast wie von selbst. Entscheidend ist neben der Notwendigkeit, eine Vorlesung zu belegen, vielleicht noch das Interesse daran.
Von: Carsten Wöhlemann
Dabei ist die Vorlesung an sich vielleicht der wichtigste Bestandteil des gesamten Studiums. Verbringt man doch den Grossteil seiner Zeit gemeinsam mit Anderen in mehr oder weniger überfüllten Hörsälen und versucht den dort vermittelten Stoff zu verstehen und abzuspeichern. Sind dann die Vorlesungen eher langweilig und monoton, besteht Gefahr, sehr schnell gedanklich abzuschweifen und einmal Verpasstes lässt sich nur mit grössten Anstrengungen wieder aufholen.
Hier kommt derjenige ins Spiel, der zu grossen Teilen für die Ausgestaltung der Vorlesung verantwortlich ist. In den meisten Fällen ein Professor seines Faches. Ihm obliegt es, seine Zuhörer zu interessieren und in bestem Falle auch für das Gehörte zu begeistern oder die gesamte Veranstaltung eher zu einer Art quälendem und zähem Monolog werden zu lassen.
Doch was garantiert eigentlich einem Professor die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Studierenden bzw. was macht diese eine gute zu einer faszinierenden Vorlesung?
SCROGGIN war an einigen Universitäten unterwegs und hat sich unter den Studierenden vor Ort umgehört. Das Ergebnis unserer kleinen und nicht ganz repräsentativen Umfrage war nicht überraschend.
Eine eher teilnahmslose Präsenz oder stupides, monotones Vor-und Ablesen seitens des Vortragenden wird durch die Bank als hinderlich für eine interessante Lehrveranstaltung empfunden.
Erst eine abwechslungsreiche und anschauliche Präsentation des zu vermittelnden Stoffes, dies gaben 15% der Befragten an, verhilft einer Vorlesung zu stehenden Ovationen unter den Zuhörern, welche bei allem Zuhören auch unbedingt mit einbezogen werden wollen (9%). Fast noch wichtiger sind für 23% der befragten Studierenden die rhetorischen und didaktischen Fähigkeiten des Prof's. Nur wenn dieser selbst Begeisterung vermittelt und über ein gewisses Charisma verfügt, lassen diese sich auch mitreissen. Hier hilft auch mal ein lockerer Spruch oder eine lustige Anmerkung. Unablässig sind ebenso eine gute Struktur sowie ein deutlich erkennbarer „roter Faden“ (13%).
Nicht unwichtig ist das richtige Tempo einer Vorlesung sowie deren Praxisbezug (14%). Der Stoff sollte weder rasend schnell durchgenommen, noch im Schneckentempo durch ständige Wiederholungen gestreckt werden. Findet hier der Vortragende das richtige Mittel und bezieht zudem das ein oder andere praktische Fallbeispiel mit ein, hat er die meisten der Anwesenden bereits auf seiner Seite.
Vereint also ein Professor die genannten Eigenschaften mit den Anforderungen der Studierenden an eine gute Vorlesung, haben alle gewonnen.
Als Student freut man sich über eine interessante Vorlesung, die hilft, auch den trockensten Stoff zu begreifen und als Professor darf man sich der Aufmerksamkeit und des Interesses seiner Zuhörer stets sicher sein.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität Neuchâtel: Tipps & Tricks
 |

Tipps für ein erfolgreiches Studium an der Universität Neuchâtel
Die Universität Neuchâtel (Université de Neuchâtel, zu Deutsch: Neuenburg) ist mit rund 4'000 Studenten eine kleine, aber sehr feine Universität, die international einen hervorragenden Ruf geniesst. Kameradschaft, Gemeinschaft und Hilfestellung von älteren Studierenden an Jüngere werden hier noch grossgeschrieben. Der fast familiäre Rahmen ermöglicht die Knüpfung von engen sozialen Netzwerken. Darüber hinaus ermöglicht er auch Lernmethoden, die an grossen Universitäten in dieser Form nicht machbar sind: Gruppenarbeiten, Seminare und regelmässige Exkursionen zusammen mit einzigartigen Lehrmethoden machen das Studium hier zu einem Lernerlebnis, denn auch die Lehrenden werden streng nach fachlicher Eignung und pädagogischer Kompetenz selektiert. All dies erlaubt ein hohes wissenschaftliches Niveau, Absolventen der Universität Neuchâtel sind bei potenziellen Arbeitgebern daher gern gesehen. Ein Drittel des Budgets wird jährlich in wissenschaftliche Zwecke investiert. Organisatorisch ist die Universität Neuchâtel in fünf Fakultäten gegliedert: Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften und Theologie. 20 Prozent der Studenten stammen aufgrund der guten Reputation der Einrichtung aus dem Ausland. Als Unterrichtssprache ist hauptsächlich das Französische in Gebrauch. Angeboten werden Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Doktorate und Weiterbildungskurse gemäß der Bologna-Reform. Die größte Fakultät ist die Faculté des Lettres et Sciences Humaines mit aktuell rund 1'500 Studierenden.
Von: Marijana Babic
Immatrikulation: Daten und Fakten
Unter dem Link http://www2.unine.ch/webdav/site/unine_futuretudiant/shared/documents/DI... ist das Anmeldeformular zu finden sowie alle Angaben, welche Unterlagen zur Immatrikulation noch erforderlich sind. Wichtig dabei ist, dass die Unterlagen komplett eingereicht werden müssen, ansonsten bleiben sie unbearbeitet. Deswegen ist es ratsam, sich frühzeitig um die Beschaffung aller notwendigen Dokumente zu kümmern, damit alles reibungslos klappt. Mit einem Dokumentenmanagementsystem behält man die Übersicht über die notwendigen Formalien. Studienaspiranten mit einer Schweizer Maturität werden grundsätzlich zu allen Fächern zugelassen. Ausländische Bewerber bzw. Bewerber, die keine Maturität nach Schweizer Standard vorweisen können, können Fragen mit der zuständigen Stelle, der Registration and Mobility Services, abklären: Telefon +41 (0)32 718 10 00, E-Mail: bureau.immatriculation@unine.ch. Bei einem günstigen Handy mit Vertrag bleiben auch die Telefonkosten in die Schweiz im Rahmen. Für das Herbst-/Wintersemester müssen sich Studienanfänger spätestens bis zum 30. April eingeschrieben haben, für das Frühlings-/Sommersemester spätestens bis zum 30. November. Für das Fach Medizin gilt die Deadline vom 15. Februar. Studenten, die zur Ergänzung ihrer Hochschulberechtigung das Freiburger Examen ablegen müssen, sind gehalten, ihr Gesuch zur Immatrikulation früher einzureichen. Wertvolle Hinweise für die Immatrikulationsprozedur gibt die Broschüre http://www2.unine.ch/webdav/site/prospectivestudent/shared/documents/pra.... Hier sind viele Details gelistet. Besondere Regelungen gelten für angehenden Studenten aus Übersee, da die Universität Kooperationen zum Beispiel mit Quebec in Kanada, Australien oder mit Universitäten in südamerikanischen Staaten unterhält. Die oben genannte Broschüre gibt auch hier wertvolle Tipps.
Französischkenntnisse
Bis auf wenige Ausnahmen in Masterstudiengängen wird in Neuchâtel in Französisch gelehrt. Neben sonstigen Französischkursen werden daher auch speziell Sprachkurse angeboten, in deren Rahmen der Erwerb eines Bachelors sprachtechnisch ermöglicht werden soll. Speziell für Studienanfänger, deren Muttersprache nicht Französisch ist, bietet die Universität deswegen auch Kurse an, die sich nach ihren Bedürfnissen richten. Informationen hierüber sind unter http://www2.unine.ch/Jahia/site/prospectivestudent/op/edit/lang/en/pid/2... zu finden. Neben der Universität gibt es noch eine Reihe anderer Einrichtungen in Neuchâtel, die Französisch-Programme anbieten. Eine Liste gibt es unter http://www2.unine.ch/prospectivestudent/page22609.html. Aufgrund der universitären Gegebenheiten ist es dringend angeraten, sich alsbald ausreichende Französischkenntnisse anzueignen. Hierfür werden als Vorbereitung auch Sommerkurse angeboten: http://www2.unine.ch/ilcf/page6203_en.html. Insbesondere die Kurse des über 100 Jahre alten Institute of French Language and Culture werden als Grundvoraussetzung für den Bachelor of Arts angesehen. Die Tatsache, dass sich sehr viel Nicht-Frankophone unter der Studentenschaft befinden, darf nicht dazu verleiten, die eigentliche Zielsprache aus dem Blick zu verlieren. Die Studienleistungen von Nicht-Muttersprachlern werden nämlich nach den gleichen Kriterien bewertet wie die von Muttersprachlern. Eine gute Idee ist es allemal, sich mit einem Frankophonen zusammenzutun und sich gegenseitig die Sprachen im Tandem-Verfahren beizubringen. Das zeigt nicht nur häufig guten Lernerfolg, sondern ist auch individuell zugeschnitten und ermöglicht wertvolle Kontakte. Wenn anfangs die Französisch-Kenntnisse noch nicht auf einem hohen Niveau sind, leistet im Notfall auch eine professionelle Übersetzungsagentur Abhilfe.
Sprachen im Allgemeinen: Ein unschätzbares Gut
Französisch ist für das Studium unerlässlich, doch ein verhandlungssicheres Englisch ebenso. Spätestens bei der Wahl des Auslandsaufenthalts stellt sich die Frage, wohin es gehen soll und das Englische beginnt dann eine massgebliche Rolle zu spielen. Nicht vergessen werden darf auch die Tatsache, dass Unmengen an Fachliteratur nur in Englisch zur Verfügung stehen. Die Englischkenntnisse sollten zumindest ein passables Textverständnis ermöglichen. Je besser diese ausgeprägt sind, umso reibungsloser wird das Studium verlaufen. Bei den oben genannten Institutionen gibt es auch Angebote für Englisch. Bei fortgeschrittenem Niveau empfiehlt sich ebenfalls ein Tandem-Partner. Sollte noch Raum sein für eine weitere Fremdsprache sein, dann ist das wunderbar. Zu bedenken ist, dass sich schwerlich noch einmal so ideale Bedingungen für das Lernen bieten wie an einer Universität. Wenn auch die dritte Sprache nicht zur Vollendung gebracht werden kann, so sollten doch ein ausreichender passiver Wortschatz und Grundzüge des Sprachverständnisses vorhanden sein. In einer globalisierten Welt sind Sprachkenntnisse ein wahrer Schatz, der auch von künftigen Arbeitgebern entsprechend gewürdigt wird.
Wo finde ich was?
Die Universität Neuchâtel hat übersichtliche Orientierungspläne ins Netz gestellt: http://www2.unine.ch/localisation/page14221.html. Diese sollten ein guter Wegweiser sein, um sich zurechtzufinden. Da Neuchâtel nur knapp 33'000 Einwohner zählt, dürften sich hier keine weiteren Schwierigkeiten ergeben. Doch auch hier gilt wie woanders: Am besten einmal alle relevanten Orte ablaufen, um sich ein Bild der Gegebenheiten und sich vertraut zu machen.
Studienberatung: Hilfe zur Organisation
Abgesehen von den Anlaufstellen der einzelnen Fakultäten (Sekretariate), gibt es für die fünf grossen Zweige der Universität jeweils spezielle Studienberater. In der englischsprachigen Broschüre unter http://www2.unine.ch/webdav/site/prospectivestudent/shared/documents/pra... sind sowohl die Sekretariate der Fakultäten gelistet als auch die Studienberater als direkte Ansprechpartner (mit Telefonnummern). Die Broschüre ist auch gespickt mit anderen hilfreichen Adressen. An der Universität Neuchâtel wird die Hilfestellung für Studierende direkt an die Fakultäten delegiert, aber diese können fachspezifisch auch gezielter weiterhelfen als allgemeine Studienberatungen. Mit diesen sollten angehende Studenten daher noch vor Studienbeginn einen Beratungstermin vereinbaren und ausführlich Themen wie Studienplanung, fachspezifische Fragen und Grundsätzliches erörtern. Belange von (angehenden) Studenten werden an der Universität Neuchâtel grundsätzlich sehr ernst genommen - sicher auch aus dem Grund, weil die Einrichtung ihre gute Reputation behalten will. Angesichts des übersichtlichen Rahmens mit 4'000 Studierenden dürfte die Orientierung auch recht leicht fallen. Hilfreich dürfte es auch sein, sich mit der allgemeinen Studierendenvertretung in Verbindung zu setzen (Kürzel: FEN). Diese bietet als Service unter anderem an, Studenten, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten haben, zu helfen. Das Webportal findet sich unter www.unine.ch/fen. Kontaktadresse: Avenue de Clos-Brochet 10, Telefon +41 (0)32 727 68 30, E-Mail: association.fen@unine.ch. FEN vermittelt auch Kontakte zu den Fachschaften und zu anderen Studentenorganisationen. Sich mit anderen Studierenden verbinden, das ist für ein erfolgreiches Studium enorm wichtig. Es gilt daher, die übersichtlichen Rahmenbedingungen in Neuenburg zu nutzen – zumal die Universität für die dort herrschende Hilfsbereitschaft bekannt ist. Zur allgemeinen Planung der Belegung von Kursen und Seminare gibt es eine Suchmaschine auf der Websites der Universität, wo alle Veranstaltungen nach Fakultäten und Fächern gelistet sind: http://vm-delta-13.unine.ch/pidhoweb/. Prüfungen (abgesehen von Referaten und Hausarbeiten) finden an der Universität zu bestimmten Terminen statt: Eine nach Fakultäten geordnete Liste für das Jahr 2011 gibt es unter http://www2.unine.ch/webdav/site/unine_futuretudiant/shared/documents/Da....
Wie finde ich mich in den Bibliotheken zurecht?
Die Bibliothek der Universität ist in 19 Teilbibliotheken gegliedert, die eng an die jeweiligen Fächer angegliedert sind. Ausserdem ist Neuchâtel an den Bibliothekenverbund RERO angegliedert, der Austausch mit anderen Bibliotheken (zum Beispiel Fernleihe) ermöglicht. Mit der Immatrikulation ist jeder Student automatisch für die Bibliotheken nutzungsberechtigt. Nach Medien kann einfach online gesucht werden unter http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj. Grundsätzlich ist es auch möglich, nach Fächern zu recherchieren. Unter dem Plan http://www2.unine.ch/webdav/site/bibliotheque/shared/images/plan_biblio.jpg finden sich alle Teilbibliotheken. Alle Öffnungszeiten mit Kontaktpersonen und Telefonnummern sind unter http://www2.unine.ch/bibliotheque/page22088.html gelistet. Sicher wäre es sinnvoll, sich dabei nach Führungen zu erkundigen, um die Bibliotheken kennenzulernen. Da ohne Fachliteratur kein Studium denkbar ist, sollten Aspiranten möglicherweise schon im Vorfeld eine solche Einführung abklären und sich beizeiten intensiv mit Literaturbeschaffung und allen damit zusammenhängenden Prozeduren auseinandersetzen. Insbesondere dann, wenn eine Immatrikulation an der geisteswissenschaftlichen Fakultät geplant ist. Da die Universität grossen Wert auf ein studentenfreundliches Umfeld legt, dürften die Kontaktpersonen gerne Auskünfte geben.
Auslandsaufenthalte: Der Blick über den Tellerrand
Die Universität Neuenburg unterhält verschiedene Kooperation mit anderen Universitäten in der Schweiz selbst, in Europa (ERASMUS) und in Übersee. Da die Website der Universität nur wenig darüber verrät, dürfte es hilfreich sein, sich mit folgenden Kontaktstellen in Verbindung zu setzen und sich zu informieren: Service immatriculation et mobilité (SIM), Bureau de la mobilité (face au bureau B 37), Avenue du 1er-Mars 26, Telefon +41 (0)32 718 10 12, E-Mail: bureau.mobilite@unine.ch. Direkt zuständig ist Michele Maurer, die für die diesbezügliche Studentenberatung verantwortlich ist. Ob nun Übersee oder ein Aufenthalt an einer anderen Schweizer Universität, ein bis zwei Semester ausserhalb des gewohnten Umfelds können neue Einblicke gewähren, Kontaktmöglichkeiten eröffnen oder der Sprachverbesserung dienen. Oft ist ein Auslandsaufenthalt eine bleibende Erfahrung, an die sich Austauschstudenten gerne erinnern.
Schwerpunkt Forschung: Sich rechtzeitig verbinden
Forschung wird an der Universität Neuchâtel grossgeschrieben und in Forschungsprojekte wird viel Geld investiert. Als Student gilt es daher, sich beizeiten in interessante Projekte einzuklinken. Dies bietet zum einen Verdienstmöglichkeiten, außerdem wird der wissenschaftliche Horizont erweitert und fundiert. Ferner sind solche Projekte ein guter Grundstein für eventuelle Weiterbildungen (wie etwa ein Masterstudium). Solche Referenzen sind für spätere Arbeitsstellen ebenso keinesfalls zu unterschätzen. Ansprechpartner sind zum einen die Berater an den Fakultäten (siehe oben), die sicher eine Menge Hinweise geben können. Der kleine Rahmen ermöglicht dabei eine enge Zusammenarbeit mit anderen Forschern, die deswegen sehr fruchtbar sein kann. Wertvolle Details gibt es auf der Forschungsseite http://www2.unine.ch/recherche. In der Linkleiste sind sowohl Ansprechpartner, Organisation von Forschungsprojekten und Forschungsfelder nach Fakultäten gelistet. Für Jungforscher gibt es intensive Förderung. Sicher lohnt sich daher ein regelmäßiger Blick in die „uninews“, ein Magazin, das in bestimmten Abständen über Forschungstätigkeiten in Neuchâtel berichtet und unter http://www2.unine.ch/recherche/page28378.html zu finden ist. Dies ist eine gute Gelegenheit, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Universität pflegt vor allem auch Forschungskooperationen an der Elfenbeinküste. Die Forschungsseite gibt darüber Auskünfte. Vieles dürfte sich auch im Verlaufe des Studiums ergeben, Informationen können in den Veranstaltungen, am jeweiligen schwarzen Brett oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda auftauchen. Auf jeden Fall gilt es, Ohren und Augen offenzuhalten und rechtzeitig zuzugreifen, wenn sich eine attraktive Chance bietet.
Wissenschaftliches Niveau und Anforderungen
Die Universität Neuchâtel geniesst international einen hervorragenden Ruf, insbesondere in den Bereichen Ethnologie, Biologie, Mikrotechnik, Gesundheitsrecht und Wirtschaftswissenschaften. Bei allen Vorzügen sollten sich Studienanfänger dessen bewusst sein, dass auch ein gewisser Standard von den Studenten verlangt wird. Schon früh am Ball bleiben, sich fristgerecht für Prüfungen anmelden und frühzeitig mit den Vorbereitungen beginnen: Das sind wesentliche Faktoren. Voraussetzung sind die Fähigkeiten, sich organisieren zu können, über Selbstdisziplin zu verfügen und sich Perspektiven in verschiedenen Bereichen gleichzeitig aufbauen zu können. Das selbstgestaltete Arbeitspensum sollte daher genauso wenig unterschätzt werden wie die von aussen gestellten Anforderungen.
|
Die wichtigsten Aspekte eines Studiums kurz und knapp: Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität Genf: Tipps & Tricks
 |

Tipps für ein erfolgreiches Studium an der Universität Genf
Mit knapp 14'500 eingeschriebenen Studenten ist die über 450 Jahre alte Universität Genf (Université de Genève) die zweitgrößte Universität in der Schweiz, die von Jean Calvin persönlich gegründet wurde. Sie gehört zu den ältesten Universitäten Europas und zu den renommiertesten Hochschulen weltweit und hat in einem Ranking in Europa den dritten Platz belegt (weltweit: Platz 28). Sieben Fakultäten bieten ein breites Spektrum an Studienmöglichkeiten an, von der Medizin über Wirtschafts- und Geisteswissenschaften bis zu den Rechtswissenschaften. Hinzu kommen eine Übersetzungsschule und autonome Institute, die zumeist mit internationalen Organisationen vernetzt sind und daher für Studierende mit international ausgerichteten Fächern besonders interessant sind. Die Universität ist den Reformen von Bologna verpflichtet und bietet (abgesehen von auf ein Doktorat ausgelegte Studien) Bachelor- und Masterstudiengänge an. Mit der Situierung in der internationalen Stadt Genf, wo unter anderem die WHO ihren Hauptsitz hat, hat auch die Universität internationales Flair. Über ein Drittel der Studentenschaft besteht aus Studierenden ausländischer Herkunft, fast 60 Prozent sind Frauen. Da es sich um eine recht grosse Einrichtung handelt, existieren viele Leitlinien und Hilfsmöglichkeiten für Studienanfänger, um sich nicht im – auf den ersten Blick - universitären Dschungel zu verlieren. Die Unterrichtssprache ist überwiegend Französisch, auch die wichtige Website www.unige.ch ist zumeist französisch gehalten. Für diejenigen, deren Muttersprache nicht Französisch ist, mag die Broschüre unter http://www.unige.ch/international/etudageneve/etudier_UNIGE_eng_2010.pdf. für den Anfang weiterhelfen.
Von: Marijana Babic
Einführungstage: Ein Besuch in der Universität Genf
Die Universität hält regelmässig einen Einführungstag ab, an welchem alle Fächer für künftige Studenten vorgestellt werden. Informationen und eine aktuelle Broschüre gibt es jeweils unter http://www.unige.ch/futursetudiants/collegiens10.html. Für 2011 ist der Einführungstag schon vorbei, doch Aspiranten sollten sich regelmäßig unter diesem Link umschauen, was sich Neues tut. Falls möglich, sollten angehende Studenten an diesem Tag teilnehmen, weil neben der Fächervorstellung auch schon Insider-Wissen vermittelt wird und sich möglicherweise der eine oder andere Kontakt ergibt und ein Gesamteindruck von der Universität entsteht. Eine wichtige Kontaktadresse für künftige Studenten ist futursetudiants@unige.ch. Hier können von angehenden Studenten Fragen gestellt und Details geklärt werden bzw. sie werden an die zuständigen Stellen weiterverwiesen.
Einschreiben: Einfach und unkompliziert
Unter dem Link http://www.unige.ch/dase/immatriculation/immatriculer10.pdf ist die Leitbroschüre zu finden, wie die Immatrikulation zu erfolgen hat. Diese erfordert die Vorlage eines Personalausweises und des Abschlusszeugnisses der Matura, falls bereits vorhanden. Hat der Studienbewerber schon andere akademische Abschlüsse absolviert, sind diese ebenfalls vorzulegen. Das Einschreibeformular ist erhältlich beim Espace administratif des étudiants, Uni Dufour, bureau 222, 24 rue Général-Dufour, 1211 Genève 4 (Telefon +41 (0)22 379 71 11, E-Mail: immat@unige.ch). Das Formular ist vor dem 30. April abzuschicken. Bewerber, die keine Schweizer Matura haben, müssen gegebenenfalls klären, ob ihr Abschluss ausreichend ist und anerkannt wird. Besonders an der Universität Genf ist, dass auch im Berufsleben Stehende ohne Matura dank einem speziellen Aufnahmeverfahren studieren können (mit Ausnahme von Medizin). Die Studiengebühren betragen 500 CHF pro Semester. Online ist es möglich, sich unter www.unige.ch/dase/immatriculation/Immatenglish.html einzuschreiben. Die Deadlines für besondere Fächer sind: 31. Januar, Schule für Übersetzen und Dolmetschen, 15. Februar, Deadline für Medizin, 28. Februar, Deadline für die Fakultät der Wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften.
Hilfestellung beim Studium: Zeitmanagement und mehr
Die Universität Genf offeriert speziell Studienanfängern eine Reihe von Hilfestellungen, um mit dem Universitätsbetrieb zurechtzukommen und um ihre eigenen Lernmethoden effizient zu gestalten. Neben Zeit- und Prüfungsmanagement steht ein spezielles Team auch für sonstige Fragen zur Verfügung (Kontakt: SOS-etu@unige.ch). Alle Informationen über die Studienangebote an der Universität Genf sind ferner in der Broschüre http://www.unige.ch/dase/immatriculation/Immatenglish/Studying_UNIGE.pdf gelistet (englisch). Unter http://www.unige.ch/futursetudiants/formation/conseillers.html sind alle Ansprechpartner für Studienfragen nach Fakultäten aufgeführt. Beim Klick auf den jeweiligen Fakultätslink wird die Kontaktperson angezeigt. Ein Service für Studenten wird auch unter http://www.unige.ch/lettres/infos/contact/service-etu.html genannt. Kurspläne gibt es unter http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_rech_cours.debut. Desweiteren bietet ein Forum „Reussir ses études“ („erfolgreich studieren“) Kurse an, die Gedächtnistraining, Prüfungsvorbereitung, Zeitmanagement und mehr beinhalten. Es ist möglich, sich unter http://cms.unige.ch/outils/limesurvey187/index.php?sid=13742⟨=fr für diese Kurse anzumelden. Ausserdem wird ein Test angeboten, um die eigenen Studienstrategien zu evaluieren und so zu möglicherweise effektiveren Techniken zu entwickeln. Unverzichtbarer Bestandteil eines erfolgreichen Studiums ist der Austausch mit Kommilitonen, gegebenenfalls mit der Bildung von Arbeitsgruppen. Grundsätzlich gilt dabei gemäss der Reform von Bologna, dass Bachelor-Abschlüsse mit 180 Kreditpunkten (Leistungspunkten) erreicht werden können, Master-Abschlüsse mit 120 bzw. 90 Kreditpunkten. Diese erforderlichen Leistungsnachweise sollten ökonomisch über die sechs Semester verteilt werden. Wie das am besten zu bewerkstelligen ist, dafür können die genannten Adressen, Dozenten und auch Kommilitonen Tipps geben. Zuzugreifen gilt es auch dann, wenn zu Kursen oder Seminaren Tutorien angeboten werden, die meist von älteren Semestern geleitet werden. Hier können Fragen gestellt und Wissen vertieft werden. Der Mehraufwand an Zeit und Arbeit lohnt sich allemal. Nicht zuletzt steht auch das „Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue“ zur Verfügung, das bei Orientierungs- und Berufsfragen zur Seite steht. Kontakt: http://www.ge.ch/ofpc/contacts.asp. Hier werden auch Fragen zur Bibliothek beantwortet und es kann ebenfalls über persönliche Probleme im Universitätsleben gesprochen werden. Falls ein Studienwechsel erwägt wird, ist der Student hier an der richtigen Stelle. Trotz aller Hilfestellung sollte der angehende Student berücksichtigen, dass es sich in Genf um einen großen Universitätsbetrieb handelt und vieles von der eigenen Motivation, Disziplin und dem Organisationsvermögen abhängt. Eigenverantwortlichkeit und Konsequenz sind daher wichtige Stichwörter, die zu einem erfolgreichen Studium dazugehören.
Sprachkurse: Effektiv Französisch lernen
Die Universität Genf bietet während der Sommermonate (kostenpflichtige) Intensiv-Sprachkurse auf verschiedenen Sprachniveaus an. Künftige Studenten, die ihre Sprachkenntnisse vor Studienbeginn aufbessern wollen, sind hier richtig: www.fle.unige.ch. Insbesondere, wenn die Sprachdefizite noch ausgeprägt sind, der- oder diejenige aber in Genf studieren will, ist ein solcher Sprachkurs empfehlenswert. Dies gilt auch dann, wenn während des beginnenden Studiums bemerkt wird, dass noch Lücken da sind. Obwohl durch das multikulturelle Ambiente häufig Deutsch- oder Englischsprachige anzutreffen sind, was die Konversation erleichtern mag, so werden auch Nicht-Frankophone in ihren Leistungen an denen ihrer französischsprachigen Kommilitonen gemessen. Daher gilt es, sich auf das Französische zu konzentrieren und auch den Kontakt zu Frankophonen zu suchen. Ein wichtiges Angebot ist das Tandem-Lernen, was bedeutet, dass sich der angehende Student mit einem französischen Muttersprachler zusammentut, um gemeinsam die jeweils andere Sprache zu lernen (http://www.unige.ch/tandems/index.html). Die Kontaktadresse für Tandem-Lernen ist: tandems@unige.ch. Für diejenigen Studienanwärter, deren Muttersprache nicht Französisch ist, seien die Intensiv-Kurse empfohlen. Immerhin gilt es, auf wissenschaftlichem Niveau an einer internationalen Universität mitzuhalten. Angeraten ist es in diesen Fällen auch, sich schon vorher intensiv mit der französischen Sprache und dem frankophonen Raum auseinanderzusetzen. Nur ein kleiner Teil der Kurse wird auf Englisch gehalten. Kurse, die in Englisch oder in Englisch und Französisch abgehalten werden, sind unter http://www.unige.ch/international/mobint/ProgrammeIN/progranglais/Form_e... gelistet.
Die Bibliotheken: Die Welt des Wissens
Die Genfer Universitätsbibliothek umfasst 50 Spezialbibliotheken, die nach Fächern sortiert sind. Der Bestand beläuft sich auf rund zwei Millionen Bücher, die meisten davon sind dabei praktischerweise Freihandexemplare. Es besteht eine Verbindung zu den Bibliotheken der Stadt Genf und dem Umland. Ausserdem ist die Universitätsbibliothek Teil von RERO, dem Westschweizer Bibliotheken-Netzwerk. So sind in Genf rund fünf Millionen Bücher, ausserdem Fachzeitschriften, E-Books und sonstige Dokumente online zugänglich. Online-Recherche, Arbeitsplätze, Computer und Ausleihe sind in jeder der Bibliotheken möglich bzw. vorhanden. Online recherchiert werden kann unter http://opac.rero.ch/gateway?skin=ge. Studenten der Universität sind automatisch benutzungsberechtigt. Der Bibliotheksausweis wird gegen Vorlage des Personalausweises ausgehändigt. Da die Handhabung der Bibliotheken nicht unbedingt immer einfach ist, sind Führungen und Nutzungseinweisungen möglich bzw. empfehlenswert. Hierzu besteht eine Kontaktmöglichkeit unter Telefon +41 (0)22 418 28 60. Angehende Studenten sollten sich dessen bewusst sein, dass die Bibliotheken zum Studieren unbedingt dazugehören. Daher sollte schnellstmöglich Gebrauch gemacht werden von einer Führung bzw. Einweisung. Häufig bieten auch Professoren und Dozenten der jeweiligen Fakultäten spezielle Einführungen in die relevanten Teile der Bibliotheken an. Der Studienerfolg hängt letztlich maßgeblich davon ab, wie erfolgreich ein Student mit Fachliteratur umgehen kann. Daher sollte jede Gelegenheit genutzt werden, um sich mit dem auf den ersten Blick komplizierten System vertraut zu machen. Nicht zuletzt auch unter dem Aspekt, dass die umfangreichen Kataloge und die Fülle von katalogisierter Literatur auch das wissenschaftliche Arbeiten vereinfachen. Zu Hause ist eine Software für Dokumentenmanagement hilfreich, um die notwendige Literatur zu verwalten.
Auslandssemester: Interkultureller Austausch für mehr Perspektiven
Die Universität Genf pflegt zahlreiche Kooperationen zu Einrichtungen im In- und Ausland. Da wäre zum einen das ERASMUS-Programm, ein Netzwerk, das sich europaweit erstreckt. Desweiteren bestehen Verbindungen zu Universitäten im ebenfalls französischsprachigen Quebec in Kanada. Ausserdem pflegt Genf die Groupe Coimbra, die eine Reihe von renommierten europäischen Universitäten mit einschliesst. Die Ansprechpartner werden angezeigt, wenn auf der Seite http://www.unige.ch/international/mobint/outgeneral/ouetudiant.html den jeweiligen Links gefolgt wird. Insgesamt arbeitet die Universität Genf mit 80 verschiedenen Hochschulen auf allen fünf Kontinenten zusammen. Ein Auslandsaufenthalt ermöglicht zum einen eine Verbesserung der Zielsprache, die womöglich mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann, welches wiederum im Berufsleben nützlich ist. Ausserdem ermöglicht ein Auslandssemester Einblick in fremde Welten, die sich auf den eigenen Horizont bereichernd auswirken. Abgesehen davon ist ein Auslandsaufenthalt für das Berufsleben mittlerweile ein Muss, da er von der geforderten Flexibilität und Internationalität zeugt. Als Absolvent bieten sich unter anderem Berufschancen bei einem professionellen Übersetzungsbüro. Ausländische Studenten, die in Genf ein Auslandsstudium absolvieren möchten, finden Ansprechpartner und alle wichtigen Informationen unter http://www.unige.ch/international/mobint/ProgrammeIN/Factsheet10_11.pdf oder http://www.unige.ch/international/mobint/ProgrammeIN_en.html. Wichtig ist, dass die Heimuniversität alle wichtigen Schritte bereits eingeleitet hat, denn die Bewerbung erfolgt vor Ort. Was für das Auslandssemester gilt, das gilt unter Umständen auch für das Inlandssemester: Die Universität Genf bietet so wie andere Hochschulen in der Schweiz an, ein Semester an einer anderen Schweizer Universität zu verbringen. Im Vordergrund steht hier weniger der Spracherwerb als der wissenschaftliche Austausch. Was nun zu bevorzugen ist, muss der einzelne selbst entscheiden.
|
Studentenverbindungen helfen verbinden Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der EPFL Lausanne: Tipps & Tricks
 |

Die École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL): Eine Hochburg der Wissenschaft
Die École polytechnique fédérale de Lausanne gilt als Hochburg der Forschung und als eine der ersten Adressen für Biowissenschaften, Technik, Physik, Chemie und Fächer ähnlicher Ausrichtung (Listung: http://bachelor.epfl.ch/programmes). Knapp über 7'000 Studenten bevölkern Campus und Hörsäle der Hochschule in Lausanne und machen den Hochschulbetrieb lebendig. Mit ihrer streng wissenschaftlichen Ausrichtung betont die École polytechnique fédérale de Lausanne gleich eingangs, dass trotz guter Strukturierung des Studiums der Erfolg massgeblich von der Disziplin und Arbeitswilligkeit des Einzelnen abhängt. Ein Studium an der EPFL ist allemal ein Vollzeitjob, der ganzen Einsatz erfordert. Doch der übersichtliche Rahmen und die große Transparenz ermöglichen gute Orientierungsmöglichkeiten in diesem hochwissenschaftlichen Betrieb. Nicht zuletzt dürfte die Tatsache, dass ein erfolgreich an der EPFL absolviertes Studium die beste Visitenkarte im Berufsleben überhaupt ist, ein Ansporn sein.
Von: Marijana Babic
Grundsätzliches: Studienerfordernisse an der EPFL
Jeder Aspirant muss sich aber darüber im Klaren sein, dass an der EPFL Selbstdisziplin und Arbeitswille absolut vorausgesetzt werden. Die Vorteile der EPFL liegen jedoch auf der Hand: Das Studium bietet konkrete Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten. Angewandte Mathematik zum Beispiel birgt erhebliche Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, vor allem wenn im späteren Berufsleben die Industrie der Zielpunkt ist. Studien an der EPFL sind somit eine unmittelbare Vorbereitung für ein erfolgreiches Berufsleben. Studien an der EPFL sind aber auch besonders intensiv und erfordern nicht nur gutes Organisationsvermögen, sondern auch Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit. Dieser Tatsache ist man sich an der EPFL bewusst. Das Angebot SAE bietet deswegen zum Beispiel Möglichkeiten, um Techniken des Lernens, Behaltens und Präsentierens zu üben. Das Büro ist nach Absprache geöffnet. Kontakt: Student Services, E-Mail: student.services@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45. Hier bietet sich auch die Gelegenheit, Kontakte zu denjenigen Studenten zu knüpfen, die ähnliche Fragen bewegen. An der EPFL ist es auch grundsätzlich wichtig, sich frühzeitig zu Arbeitsgemeinschaften zusammenzuschliessen und den Kontakt zu Kommilitonen zu pflegen. Der intensive Lehrstoff ist nur durch Planen, Konsequenz und soziale Integration zu bewältigen. Möglich ist es auch, zunächst ein Vorbereitungsjahr zu absolvieren, um von der Lawine der Wissenschaft nicht gleich überrollt zu werden und eine Akklimatisationsphase zu durchlaufen (Informationen unter: http://bachelor.epfl.ch/files/content/sites/bachelor/files/shared/brochu...). Nützliche Broschüren als Einstiegslektüre über ein Studium an der EPFL stehen unter http://bachelor.epfl.ch/page-5909-de.html zum Download bereit. Im Folgenden finden sich die wichtigsten Tipps und Anlaufstellen, um an dieser renommierten und fordernden Hochschule, die einige weltweit herausragende Wissenschaftler beherbergt, erfolgreich zu sein.
Ein wichtiges Instrument zur Orientierung: Website der EPFL
Um auf dem Laufendem zu bleiben und um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, ist ein regelmässiger Besuch der Website http://www.epfl.ch/ von Vorteil. Sie ist gespickt mit äusserst wertvollen Informationen, die Navigation ist einfach und benutzerfreundlich. Die Seite ist dabei vorwiegend in Französisch gehalten, streckenweise steht auch eine englische Sprachauswahl zur Verfügung. Nur ein kleiner Teil ist in Deutsch übersetzt.
Nicht verpassen: Einführungsveranstaltungen zum Reinschnuppern
An der EPFL finden die nächsten Einführungstage für Studieninteressierte vom 10. bis zum 11. März sowie vom 17. bis 18. März 2011 statt. Dabei werden alle Bachelorfächer ausführlich präsentiert, auch Lehrende stellen sich vor. Kontaktperson ist Ingrid de Mesel (E-Mail: ingrid.demesel@epfl.ch, Telefon +41 (0)21 693 5071), die auch erste Fragen vorab telefonisch beantworten kann. Diese Einführungstage sind sehr empfehlenswert, um erstmals die Luft der EPFL zu schnuppern, sich einen Eindruck vom Betrieb zu verschaffen und möglicherweise auch schon Kontakte zu knüpfen, die später hilfreich sein können. Die Einführungstage vermitteln einerseits die faszinierende Welt der Wissenschaft, wie sie in Lausanne gelehrt wird, andererseits können sie sicher auch Entscheidungsfragen erleichtern. An anderen Hochschulen, besonders für den Bereich Kunst, bietet man den Studenten in spe Mappenvorbereitungskurse an. Die Wahrscheinlichkeit, einen Studienplatz zu erhalten, steigt und man kann sich durch einen Kurs schon ein wenig auf das Studium einzustimmen und sein Talent testen.
Struktur der EPFL: Studienabschlüsse, Unterrichtssprache, Zulassung
Die EPFL bietet klassisch gemäss der Bologna-Reform Bachelor- und Masterstudiengänge an. Um den Bachelor-Grad zu erreichen, müssen 180 Kreditpunkte (Leistungsnachweise) erbracht werden, für den Master sind weitere 120 erforderlich. Zugelassen wird grundsätzlich jeder, der eine Schweizer Maturität oder einen vergleichbaren, anerkannten Abschluss vorweisen kann. Bei sonstigen ausländischen Abschlüssen muss die Zulassung geklärt werden (Hilfe für diese Fragen gibt es beispielsweise bei: Studienhilfe, E-Mail: services.etudiants@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45). Im Zweifel sollte ebenfalls erfragt werden, ob die Zeugnisse in einer beglaubigten Übersetzung vorgelegt werden müssen. In diesem Fall empfiehlt es sich, ein professionelles Übersetzungsbüro damit zu beauftragen. Die Unterrichtssprachen sind Französisch, da Lausanne in der französischsprachigen Schweiz liegt, und Englisch. Für die jeweilige Unterrichtssprache sollten mindestens Kenntnisse auf dem Level C1 nach internationalem Standard vorliegen, um erfolgreich am Hochschulbetrieb teilnehmen zu können. Um etwaige Sprachdefizite auszugleichen, gibt es das Sprachenzentrum, das Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch auch in Intensivkursen anbietet (http://langues.epfl.ch/). Empfehlenswert ist – wie meist – das Tandemsystem: das heisst, zwei Muttersprachler verschiedener Sprachen verbinden sich und lernen zusammen. Für das Sprachenzentrum kann sich jeder online auf der genannten Website kostenlos anmelden.
Mathematikkenntnisse
Die EPFL ohne Mathematik ist nicht denkbar. Fortgeschrittene Mathematikkenntnisse sind an der Hochschule auf jeden Fall von Vorteil (mit Ausnahme des Fachs Architektur, das anders ausgerichtet ist). Die Wahrscheinlichkeit, das erste Studienjahr zu überstehen, ist dann statistisch gesehen erheblich grösser. Doch wer glaubt, über diese Kenntnisse nicht zu verfügen, muss nicht verzagen: In dem Kurs „PolyMaths“ werden jeweils im Frühjahr mathematische und physikalische Fertigkeiten auf wissenschaftlichem Niveau vermittelt. Der Kurs gilt als beste Einführung in die polytechnischen Studiengänge überhaupt (der Link zum Kurs befindet sich unter http://bachelor.epfl.ch/cms/site/bachelor/op/edit/page-5808.html). Abgesehen davon werden die Mathematikkenntnisse jedes Einzelnen schon vor Studienbeginn ausgewertet. Für mögliche Defizite können dann zielgerichtet Lösungen gesucht werden. Ausserdem wird allen Studienanfängern das französischsprachige Buch „Savoir-faire en mathématiques pour bien réussir à l'EPFL“ vor Beginn ausgehändigt, das sich ausführlich mit dem Thema Mathematik und EPFL beschäftigt, aber auch die Wichtigkeit dieses Fachs für das Studium unterstreicht. Die Hochschule weist aber auch klar darauf hin: Um an der EPFL erfolgreich studieren zu können, muss man Spass an der Mathematik haben und gerne praxisorientiert mit ihr arbeiten. Der Wille zu permanenter Zielstrebigkeit und Konsequenz bei der Anwendung mathematischer Kenntnisse gehört ausserdem dazu.
Stundenpläne und Studienhilfe: Wichtige Adressen
Hilfe für die Erstellung der enorm wichtigen Stundenpläne bietet folgender Link: http://bachelor.epfl.ch/cms/page-5911.html. Dort gibt es Kursbeschreibungen und Stundenpläne für das erste Studienjahr. Wissenswertes über die Bachelor-Angebote ist erhältlich unter http://bachelor.epfl.ch/cms/op/edit/lang/en/programmes. Dabei werden auch die jeweiligen Kontaktpersonen auf der rechten Leiste gelistet, wenn das entsprechende Fach aufgerufen wird. Das sind die Ansprechpartner, die Informationen rund um das Fach geben können.
Studienhilfe
Stets mit dabei ist der Hinweis auf die Studienhilfe bzw. Studienberatung (Guichet des étudiants oder Student Help Desk): E-Mail services.etudiants@epfl.ch, Telefon +41 (0) 21 693 43 45. Diese Anlaufstelle sollte jeder Studienanfänger aufsuchen, am besten noch vor Studienbeginn, denn sie kümmert sich um alle studentischen und akademischen Belange. Auf der Seite für Anfänger im Bachelor-Studium sind alle Immatrikulationsfristen und sonstigen Erfordernisse wie Einreichungsunterlagen für die Immatrikulation für das Studium an der EPFL gelistet. Die Studienberatung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wo die Studienberatung zu finden ist? Dies zeigt der Lageplan unter http://plan.epfl.ch/?lang=fr&room=bp+1229. Die Studienhilfe empfiehlt allen Studienanfängern regelmässig die Seite http://studying.epfl.ch/bienvenueBachelor aufzusuchen und sich nach dem Neuesten zu erkundigen. Die Seite bietet ausserdem Tipps per Video, wie sich Studenten in Kurse einschreiben können. Die Studienhilfe organisiert ebenfalls die Vermittlung „Studenten antworten Studenten“: http://bachelor.epfl.ch/studentsonline. Ein durchaus nützliches Angebot, denn wer kann Studienanfänger besser verstehen als Studenten selbst? Das Forum ist auch ein wichtiges Instrument, um sich zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Hilfreich ist die Studienberatung auch, wenn der akademische Nachwuchs vor der Frage steht, welcher Schwerpunkt für das Studium gewählt werden sollte. Denn an der EPFL ist die Festlegung auf einen Schwerpunkt im jeweiligen Fach erforderlich. Da diese Entscheidung wegweisend ist für das weitere Studium ist, sollte jeder Studienanfänger die Beratungsmöglichkeiten der Studienberatung in Anspruch nehmen. Diese kann auch helfen, falls ein Student bei seiner Entscheidung falsch lag und einen Wechsel möchte. Wer sein Studium erst beginnen möchte und fachlichen Rat braucht, kann ein persönliches Gespräch vereinbaren, das diskret behandelt wird.
Immatrikulation: Wie schreibe ich mich ein?
Die Immatrikulation erfolgt online, wobei die Online-Plattform nur vom 18. Januar bis zum 30. April geöffnet ist. Die Anmeldung wird ausgefüllt, ausgedruckt und per Post an die EPFL verschickt. Unter http://bachelor.epfl.ch/page-5915.html ist aufgeführt, was noch zur Immatrikulation vorgelegt werden muss. Die Postadresse, an die die Unterlagen geschickt werden, ist: EPFL AA-DAF SAC, Bâtiment Polyvalent 1233, Station 16, CH-1015 Lausanne. Kontaktadresse ist: Telefon +41 (0)21 693 43 45, E-Mail services.etudiants@epfl.ch. Die Studiengebühren betragen 633 CHF pro Semester.
Bibliothek: Wie komme ich am besten an Wissen?
Das Bibliothekssystem in Lausanne arbeitet mit dem Verbund NEBIS und umfasst rund 4,2 Millionen Bände, wozu noch Zeitschriften, elektronische Zeitschriften, E-Books, etc., hinzukommen. Studenten der EPFL haben automatisch eine Berechtigung für die Bibliothek. Die umfassende Dokumentenarchivierung erfolgt nach einem bestimmten System, mit dem sich die Studenten vertraut machen sollten. Um ein Buch o.Ä. zu finden, wird der Katalog NEBIS benutzt: www.nebis.ch. Hier kann auch ausgeliehen werden, können zum Beispiel Zeitschriftenartikel bestellt oder Fernleihen in Auftrag gegeben werden. Das System ist benutzerfreundlich und arbeitet mit Stichwortsuche nach Autor und/oder Titel. Die Bibliothek ist praktischerweise sieben Tage die Woche von 7 bis 24 Uhr geöffnet. Sie befindet sich im Rolex Learning Center, Station 20, in Lausanne und ist auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. Kontakt: +41 (0)21 693 2156 oder E-Mail questions.bib@epfl.ch. Nach Absprache gibt es auch Schulungs- und Trainingsmöglichkeiten, um sich in das System der Bibliothek einführen zu lassen. Da der fachgerechte Umgang mit Literatur für ein erfolgreiches Studium unerlässlich ist, sollte sich jeder Studienanfänger zu mindestens einer Führung einfinden und sich ausführlich in die Bibliothek einweisen lassen.
Austauschprogramme: Der Draht zur Welt
Die EPFL bietet Bachelor-Studenten im dritten Jahr einen Aufenthalt in einer der 190 Partneruniversitäten weltweit an. Studenten, die ausserhalb Europas ein Austauschprogramm belegen wollen, müssen einen Durchschnitt von mindestens 5.0 vorweisen können, Austauschwillige, die innerhalb Europas ein Auslandssemester planen, einen Durchschnitt von 4.5. Weitere Bedingung ist, dass nach dem zweiten Bachelor-Jahr mindestens 60 Kreditpunkte erreicht wurden. Die Leistungen, die im Austauschprogramm erbracht werden, werden an der EPFL angerechnet. Die Ansprechpartner für die jeweiligen Fächer/Teilgebiete finden sich unter http://jahia-prod.epfl.ch/repository/default/content/sites/sae/files/sha.... Eine Liste der Partneruniversitäten ist unter http://sae.epfl.ch/page-27066-en.html erhältlich, wobei das jeweilige Fach angeklickt werden muss. Antragsformulare können unter http://sae.epfl.ch/files/content/sites/sae/files/shared/FORMUL2010-11.pdf gefunden werden. Es ist auch angeraten, die Informationsveranstaltungen zum Thema Auslandsemester im Herbst vor dem Austausch zu besuchen. Die Termine sind unter http://sae.epfl.ch/page-33555-en.html gelistet. Da Studenten der EPFL häufig einen beruflichen Werdegang in der international operierenden Industrie anstreben, ist es notwendig, sich die entsprechenden kulturellen, sozialen und sprachlichen Fertigkeiten anzueignen. Neben der eigenen Bereicherung durch einen Auslandsaufenthalt ist dieser daher auch ein förmliches Muss für künftige Bewerbungsgespräche. Studenten, die an der EPFL ein Austauschsemester o.Ä. absolvieren wollen, müssen von ihrer jeweiligen Hochschule dazu ausgewählt worden sein. Entsprechende Französischkenntnisse sind dafür unabdingbar. Wesentliche Informationen für Studenten, die zeitweise an der EPFL studieren wollen, gibt es unter http://sae.epfl.ch/page-27094-en.html.
Behindertengerecht: Hilfe barrierefrei
Die EPFL bemüht sich besonders, auch behinderten Personen gerecht zu werden. Die Bibliothek beispielsweise ist barrierefrei. Nützliche Adressen, die auch bei der Bewältigung des Studienalltags helfen können, sind unter http://sae.epfl.ch/page-27104-en.html gelistet. Hilfreich ist auch das Team des SAE, das Büro ist aber nur nach Absprache geöffnet. Kontakt: Student Services, E-Mail: student.services@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45.
Wie finde ich mich an der EPFL zurecht?
Einen Lageplan gibt es unter https://documents.epfl.ch/groups/e/ep/epfl-unit/www/plan/EPFL-plan-campu.... Studienanfänger sollten rechtzeitig beginnen, sich auf dem Campus zu orientieren und möglicherweise zu Beginn frühzeitig zu Kursen aufbrechen, um diese auch zu finden. Der Vorteil der EPFL ist, dass es sich um einen (wenn auch großen) Komplex handelt und nicht um viele über die Stadt verstreute Gebäude. Dies kommt behinderten Personen entgegen, hilft aber auch bei der Orientierung von Studienanfängern.
|
Studentische Organisationen: Kontaktmöglichkeiten und Chancen Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität Lausanne: Tipps & Tricks
 |

Die Université de Lausanne: Einmalige Angebote in reizvoller Lage
Die Université de Lausanne liegt im französischsprachigen Kanton Waadt, dementsprechend wird schwerpunktmässig auch in Französisch unterrichtet. Die Universität liegt direkt am Genfersee inmitten einer idyllischen Landschaft mit Blick auf die Alpen. Genauer gesagt, unterhält die Hochschule drei Standorte: Das sind Dorigny, Bugnon und Epalinges, die allesamt in der Nähe von Lausanne gelegen sind. Die besonderen Kennzeichen der Universität sind neben der Ausrichtung auf das Französische die Offerte einmaliger Studienangebote wie Recht- und Kriminalwissenschaften, Biologie und Medizin sowie Geo- und Umweltwissenschaften. Ein Angebot, das in der Schweiz einzigartig ist.
Obwohl auch „herkömmliche“ Studienfächer natürlich möglich sind, liegt der Schwerpunkt auf den Human- und Naturwissenschaften. Im Jahr 2009 waren insgesamt 11'618 Studierende an der Universität Lausanne eingeschrieben, wobei viele davon das Angebot der exklusiven Fächer, die es nur in Lausanne gibt, nutzen bzw. nutzten. Dabei ist ein hoher Anteil an ausländischen Studierenden zu verzeichnen, die rund 20 Prozent der Studentenschaft ausmachen, und der Universität am Genfersee ein internationales Flair verleihen.
Von: Marijana Babic
Sprachliche Voraussetzungen: Möglichkeiten und Perspektiven
In der Regel werden Seminare, Vorlesungen, etc. in Französisch gehalten. Eine Ausnahme bilden manche Master- und Nachdiplomstudiengänge (vor allem bei den Wirtschaftswissenschaften), die ganz oder teilweise in Englisch stattfinden. Bedingung sind also gute Französisch-Kenntnisse auf Matura-Niveau. Aspiranten, deren Muttersprache nicht Französisch ist, die über keine Schweizer Matura oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen, müssen das Freiburger Examen ablegen, in dem sie Sprachkenntnisse nachweisen können. Wer nicht das Freiburger Examen ablegt, muss vor der Einschreibung in einen Bachelor-Studiengang eine Sprachprüfung ablegen. Wer die Prüfung nicht besteht, kann nicht immatrikuliert werden.
Die Universität Lausanne bietet jedoch verschiedene Möglichkeiten an, um Französisch zu lernen. Zum einen existiert die Ecole de français langue étrangère (www.unil.ch/fle), die während der Vorlesungszeiten Kurse in französischer Sprache, Landeskunde und Literatur anbietet - ein Rundumprogramm. Für die Teilnahme müssen jedoch gewisse Grundkenntnisse vorhanden sein: Die Fähigkeiten, Unterhaltungen auf Französisch zu führen, einfache Texte zu verstehen und auch schreiben zu können. Anfänger werden nicht zugelassen. In den Semesterferien gibt es die Cours de vacances (Ferienkurse, www.unil.ch/cvac) in verschiedenen Stufen.
Studieninteressierte, die sich später an der Universität Lausanne immatrikulieren wollen, sind diese Kurse besonders ans Herz zu legen, zumal es Angebote für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene gibt. Diese Kurse sind allerdings kostenpflichtig. Eine Methode, die sich auch andernorts bewährt hat, ist das Programm Tandem (www.unil.ch/tandem): Zwei Teilnehmer mit unterschiedlichen Muttersprachen treffen sich regelmässig, um voneinander die jeweils andere Sprache zu lernen. Wo, wann und wie oft sich die Teilnehmer treffen, ist ihnen selbst überlassen. Welche Form des Spracherwerbs letztlich am hilfreichsten ist, muss jeder Studienanfänger selbst entscheiden. Dies hängt auch massgeblich von den bereits vorhandenen Kenntnissen ab.
Die Tandem-Option bietet aber die Möglichkeit, eventuell jemanden kennenzulernen, der einem durch das neue Feld der Universität Lausanne auch im weiteren Sinne helfen kann. Idealerweise sollte es sich beim Gegenüber um ein älteres Semester handeln, das Orientierung geben kann. Vom Ablegen einer Eingangssprachprüfung zur Aufnahme ausgenommen sind Aspiranten, die Sprachnachweise vorlegen können, die die Universität Lausanne akzeptiert (eine vollständige Liste: http://www.unil.ch/immat/page5380_en.html).
Die Sprache verhandlungssicher zu beherrschen, ist eine Grundvoraussetzung, um an der Universität zu bestehen. Beispielsweise die Website der Hochschule, www.unil.ch, ist zwar im Bereich für ausländische Studienanwärter in Deutsch und Englisch gehalten, überwiegend aber auf Französisch. Dies gilt auch für die Auskünfte über die Bibliothek, deren Nutzung, Kataloge, etc. Es soll daher jedem, der an der Universität Lausanne studieren möchte, dringend angeraten sein, möglichst ein Jahr vor Studienbeginn einen intensiven Sprachkurs zu beginnen und sich im Verständnis französischer Texte zu üben. Um auch im wissenschaftlichen Bereich mithalten zu können, wo fein differenziert werden muss, sollten die Sprachkenntnisse so weit wie möglich ausgebaut werden.
Die Universität Lausanne legt aber auch ansonsten einen grossen Wert auf Sprachen und den interkulturellen Austausch. Gelernt werden kann – abgesehen von den regulären Französischkursen – auch Spanisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Damit trägt die Universität der internationalen Ausrichtung Rechnung, zumal sich viele Studenten etwa für ein Auslandsstudium in Spanien entscheiden. Lausanne bietet somit optimale Voraussetzungen für multifunktionale Mehrsprachigkeit in einer globalisierten Welt. Sie fordert aber auch Anpassungsfähigkeit an die örtlichen Gegebenheiten und Eigeninitiative sowie die Selbstverantwortlichkeit der Studienanfänger.
Kontakte und Verbindungen: Unerlässlich
An der Universität Lausanne gibt es eine Menge studentische Verbindungen: Von der Studierendenvertretung bis hin zu religiösen Gruppierungen. Selbstverständlich darf jeder selbst entscheiden, wem er sich wann und wo anschliesst. Wird aber möglicherweise die gängige Sprache nicht so gut beherrscht, ist es umso wichtiger, soziale Kontakte zu pflegen und damit Anschluss an die grosse Gemeinschaft zu finden. Alle universitären Gruppen sind unter http://www.unil.ch/interne/page40482.html gelistet. Empfehlenswert ist auf jeden Fall der Kontakt zur Studierendenvertretung, die sich an der Universität Lausanne Fédération des associations d'étudiantes (FAE) nennt. Sie vertritt die Studierenden gegenüber der Universitätsleitung und in der Öffentlichkeit. Diese kann fachlich, sprachlich und sozial weiterhelfen und auch den Kontakt zu den Fachschaften herstellen. Angehörige der Studierendenvertretung bringen normalerweise einen guten Teil Idealismus mit und sind vor allem Anfängern gerne behilflich. Lausanne sollte da keine Ausnahme sein. Aber auch sonst besteht kein Grund zur Panik: Rund 20 Prozent der Studenten an der Universität Lausanne sind ausländischen Ursprungs und die meisten finden sich zurecht. Unter http://www.unil.ch/interne/page40487.html sind studentische Gruppe nach Herkunft zusammengefasst bzw. haben sich zu Vereinigungen zusammengeschlossen. Es gibt auch eine Gruppe „Germania“ (http://www.unil.ch/interne/page40537.html), die entgegen dem Namen aber interkulturell ausgerichtet ist. Studienanfänger sollten aber auch nach informellen Gruppen suchen, die sich möglicherweise nur locker zusammengeschlossen haben und sich in unverbindlichem Rahmen treffen. Mit den neuen Studienfreunden kann man dann auch während der Semesterferien in einer schönen Ferienwohnung in Südfrankreich ausspannen. Dies bedeutet aber nicht, dass sich der Ausländer nur mit eigenen Landsleuten umgeben soll. Im Gegenteil: Ziel ist die Integration in eine aufregende Kultur.
Studienberatung: Wen frage ich?
Die Universität Lausanne verfügt über ein ausgebautes Beratungsnetz: http://www.unil.ch/interne/page43699.html. Vor allem interessant sein dürfte der Service d’orientation et conseil (SOC). Dieser bietet äusserst praktische Angebote: Unter Choix d’études finden sich zum Beispiel Tipps zum Arbeiten für ein erfolgreiches Studium, zur Stressbewältigung vor Prüfungen oder Ratschläge zur Orientierung in dem zunächst neuen Komplex (http://www.unil.ch/soc/page7299.html). Es handelt sich also um eine Studienberatung im eigentlichen Sinne, auch Treffen und Termine mit Fachberatern sind möglich. Adresse: Service d’orientation et conseil, Bâtiment Unicentre, Quartier Centre, Dorigny. Kontakt: Telefon +41 (0)21 692 21 30, E-Mail: orientation@unil.ch. Dieser Service packt studentische Probleme an der Wurzel: Tipps wie zum Beispiel mit einer Prüfungsvorbereitung rechtzeitig zu beginnen, Arbeiten nicht aufzuschieben oder einen realistischen Studienplan zu erstellen. Um die Übersicht über Seminararbeiten und Präsentationen zu behalten kann man auch ein gutes Dokumentenmanagementsystem verwenden. All dies sind Hinweise, die direkt aus der Praxis stammen. Zumindest ein Besuch bei diesem Service sollte machbar sein, zumal er sich auch mit Problemen bzw. Chancen ausländischer Studierender befasst. Um beizeiten einen Stundenplan erstellen zu können, findet sich eine Liste der Vorlesungsverzeichnisse zum Anklicken unter https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_isint.... Der genannte Service oder die Immatrikulationsstelle können gefragt werden, wie sich Studierende für Kurse anmelden können. Aus der Website geht dies nicht hervor. Von Bedeutung ist, dass auch die Universität Lausanne nach dem Bachelor- bzw. Master-System arbeitet. Für den Erwerb des Bachelor-Titels werden 180 Leistungspunkte oder Credits benötigt, die möglichst auf sechs Semester verteilt werden sollten. Die oben genannte Studienberatung kann sicher behilflich sein bei der Stundenplanerstellung. Ausführliche Informationen zu den Credits gibt es unter http://www.crus.ch/information-programme/bologna-ects/was-ist-ects.html?L=0. Helfen kann auch der Link http://www.unil.ch/enseignement/page23115.html, wo Leitfäden für das Studium an der Universität Lausanne heruntergeladen werden können.
|
Immatrikulation: Wie schreibe ich mich ein? Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität Fribourg: Tipps & Tricks
 |

Die Université de Fribourg: Ein besonderes Modell
Die Université de Fribourg: Zweisprachige Entwicklungsmöglichkeiten an der Schnittstelle Die Université de Fribourg, im Folgenden Universität Freiburg genannt, ist in mancherlei Hinsicht etwas Besonderes. Es handelt sich um eine zweisprachige Hochschule in der umfangreiche Bachelor- und Master-Studien in Deutsch und Französisch angeboten werden. Denn: Das südwestlich von Bern gelegene reizvolle Fribourg befindet sich in einem zweisprachigen Kanton. Die Möglichkeiten eines zweisprachigen Studiums – in manchen Veranstaltungen wird auch Englisch angeboten – sind enorm. Die Universität Freiburg bildet mit diesem Modell ein besonderes Konzept in ganz Europa, was zugleich der Vorteil eines Studiums an dieser Hochschule ist. Mit rund 10'000 Studierenden und 200 ProfessorInnen aus etwa 100 Ländern handelt es sich um eine recht familiäre Hochschule, die mit kultureller Vielfalt aufwartet: Denn nicht nur die Lehrenden stammen aus der ganzen Welt, auch die Studentenschaft ist mit Deutschsprachigen, Französischsprachigen und Studenten, deren Muttersprache das Italienische ist, bunt gemischt. Hinzu kommen zahlreiche ausländische Studierende. Fünf Fakultäten bieten dabei alle wichtigen Studienrichtungen an.
Von: Marijana Babic
Zweisprachigkeit: Was erwartet den Studienanfänger?
Zunächst einmal gilt für Studienanfänger mit Schweizer Maturität, dass Angst nicht angebracht ist. Mit Deutsch- bzw. Französischkenntnissen auf Matura-Ebene und einer mittleren Note ist das zweisprachige Studium an der Universität Freiburg ohne weitere Probleme zu bewältigen. Dabei ist es auch möglich, seine Studiengestaltung auf eine gezielte Sprache auszurichten. Einzelne Veranstaltungen werden auch in Englisch angeboten. Der Vorteil eins zweisprachigen Studiums sind zusätzliche Credits (Leistungspunkte) und ein positiver Vermerk auf dem Zeugnis, wenn je 40 Prozent des Studiums in Deutsch und Französisch absolviert wurden. Dies wiederum ist ein großer Vorteil auf dem Arbeitsmarkt, will man z. B. später in einer Übersetzungsagentur arbeiten. Ein zweisprachiges Studium bedeutet verbale, soziale und interkulturelle Kompetenzen. Das Bachelor-Angebot der Universität Freiburg ist gelistet unter http://www.unifr.ch/acadinfo/pdf/unifr_ba_studies_1112_de.pdf.
Nicht entgehen lassen: Die Informationsveranstaltungen
Das Konzept der Universität Freiburg wird bei den Informationsveranstaltungen für angehende Studierende vermittelt. Diese sind daher von besonderer Wichtigkeit: Die nächsten Infotage an der Universität Freiburg finden am 23. und 30. November 2011 statt. Die Anmeldung erfolgt über die Rektorate der Gymnasien. Ein Anmeldeformular gibt es online: http://www.unifr.ch/diracad/assets/files/unifr_infoday_application_form_.... Nicht-Maturanden, die dennoch interessiert sind, können sich unter http://www.unifr.ch/diracad/de/infoday/signup anmelden. An diesen Tagen werden die Fakultäten und Studiengänge vorgestellt. Die Teilnahme an einzelnen universitären Veranstaltungen ist auch möglich. Zu beachten ist, dass die Infotage nur an den genannten Tagen stattfinden. Der Informationstag findet wahlweise auf Deutsch oder auf Französisch statt. Unter folgendem Link sind weitere Veranstaltungen gelistet, an denen die Universität Freiburg mit einer Vorstellung ihres Angebots beteiligt ist: http://www.unifr.ch/acadinfo/de/events. Ebenso wie die Studentenzahl allgemein, so dürfte sich auch die Teilnehmerzahl an den Infotagen im Rahmen halten. Dies bietet gute Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zu vertieften Diskussionen. Im familiären Klima der Universität Freiburg werden der einzelne und seine Fragen nicht vergessen. Dieses Angebot gilt es zu nutzen. Am 2. März 2011 wird ausserdem ein Master-Day mit Vorstellung des Masterprogramms angeboten.
Die Starting Days: Ein gesamtuniversitäres Projekt mit Perspektive
Die Association générale des étudiant-e-s de Fribourg ist Träger der Starting Days, die nicht auf dem Campus selbst stattfinden, sondern in La Part-Dieu in der Nähe von Bulle. Das Programm umfasst drei Tage und beschäftigt sich mit Fragen wie: Was erwartet mich im Studium, was erwarte ich vom Studium? Wie sieht meine persönliche Entwicklung in diesem Zusammenhang aus? Wie kann ich mein Studium gestalten? Ausserdem gibt es Treffen mit ProfessorInnen zum Austausch, mit älteren Studierenden, mit studentischen Organisationen, nicht zu vergessen das gemütliche Beisammensein. Diese Veranstaltung in familiärer Atmosphäre ist sicher gut geeignet, um gleich zu Beginn des Studiums eine Perspektive und Vorstellung zu gewinnen, statt von den kommenden Anforderungen überrollt zu werden. Kontaktperson ist Estelle Zbinden Di Pasquale in der Rue Techtermann 8a in Freiburg: Telefon: +41 (0)26 300 71 74, E-Mail: starting-days@unifr.ch. Die Anmeldung kann erfolgen über http://www.unifr.ch/startingdays/de/inscription.
Erstsemestrigentag
Regelmäßig zu Studienbeginn findet der Erstsemestrigentag mit einer ausführlichen Einführung in die Universität statt. Der jeweils aktuelle Link ist unter http://www.unifr.ch/acadinfo/de/steps zu finden.
Immatrikulation und Fristen: von A bis Z
Für das Herbstsemester bildet der 30. April die letzte Frist zur Anmeldung, für das Frühjahrssemester der 30. Oktober. Das Gleiche gilt für Master-Studien. Eine Ausnahme ist das Medizinstudium, die Heilpädagogik, Biomedizinischen Wissenschaften, Sport- und Bewegungswissenschaften: Für einen Studienbeginn, der hier lediglich im Herbstsemester möglich ist, ist eine Anmeldung spätestens bis zum 15. Februar erforderlich. Ein Doktorat kann hingegen jederzeit aufgenommen werden.
Studienanfänger mit Schweizer Vorbildung
Folgende Schweizer Abschlüsse berechtigen zu einem Studium an der Universität Freiburg: Gymnasiale Maturität, Berufsmaturität mit Ergänzungsprüfungen der Schweizer Maturitätskommission, Fachhochschuldiplom oder Diplom einer Pädagogischen Hochschule. Die Anmeldung erfolgt online unter https://admin.unifr.ch/inscruni/faces/index.jsp. Die Liste der (fristgerecht) einzureichenden Dokumente findet sich unter http://www.unifr.ch/admission/assets/file/repository/CH_BA_D.pdf. Kommt der Zulassungsbescheid müssen ebenfalls fristgerecht die Semestergebühren beglichen werden (655 CHF). Danach wird die Campus-Card ausgehändigt, der eAccount wird aktiviert und Kurse können belegt werden.
Ausländische Studierende
Ausländische Studierende benötigen ein Reifezeugnis, das im Wesentlichen den Anforderungen der Schweizer Maturität entspricht. Eine Liste von Abschlüssen, die in Frage kommen, gibt es nach Ländern sortiert unter http://www.unifr.ch/admission/assets/file/repository/ListePays_2010.pdf. Falls das vorhandene Zeugnis nicht ausreicht, kann das Freiburger Examen absolviert werden: http://institute-multilingualism.ch/admission/de/procedure/freiburger-ex.... Es handelt sich dabei um eine Prüfung, die die Eignung fürs Studium nachweisen soll. Ausserdem müssen ausreichende Deutsch- und/oder Französischkenntnisse vorgewiesen werden. Die Anmeldung zum Studium erfolgt ebenfalls online unter https://admin.unifr.ch/inscruni/faces/index.jsp. Für ausländische Studierende ist dabei eine Dossiergebühr über 115 CHF zu entrichten. Alle weiteren Schritte, wie Einreichen der Dokumente und Visumsantrag, finden sich unter http://institute-multilingualism.ch/admission/de/futur/ba/foreign?sub=8#.... Die Semestergebühren für ausländische Studierende betragen 805 CHF. Auch die Dienststelle für Zulassung und Einschreibung ist für Fragen von Studienanfängern offen. Die Zulassung hat montags bis donnerstags von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, die Einschreibungs-Abteilung montags bis donnerstags von 8.30 bis 9.30 Uhr. Erstere ist im Büro 1222 zu finden, die zweite im Büro 3116 in der Avenue de l’Europe 20 in Freiburg, Telefon: +41 (0)26 300 70 20.
|
Wen kann ich fragen? – Studienberatung Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Cashare - Zugang zu Darlehen von Privaten
 |

Es gibt ab und zu Situationen während eines Studiums, in welchen man als Student zur Überbrückung eines finanziellen Engpasses bei Eltern und Verwandten nicht weiter kommt, und der dringend benötigte Aushilfsjob ist auch nicht gerade zur Hand. In solchen Situationen kann die von SF in der Sendung ECO vorgestellte Dienstleistung von Cashare eine Möglichkeit sein.
Von: Erik Streller-Shen
Gleich zu Beginn möchte ich festhalten: Ich persönlich bin der Meinung, dass man nie mehr Geld ausgeben sollte, als über das man verfügt. Doch für eine Ausbildung reichen in besonderen Fällen die finanziellen Mittel leider nicht immer aus. Kleinkredite sind eine teure Lösung, Stipendien nur bedingt erhältlich.
In solchen Fällen können Darlehen von Privaten eine Lösung sein. Cashare.ch bietet als erster Anbieter Zugang zu Darlehen von Privaten für Private. Cashare will Privatpersonen die Möglichkeit geben, sich gegenseitig in einem gesicherten Rahmen Darlehen zu geben. Dabei profitieren sämtliche Parteien von besseren Zinsen. So können die Darlehensnehmer mit tieferen Zinsen als bei Banken oder Kreditkartenunternehmen rechnen und Darlehensgeber können von höheren Zinssätzen als bei anderen Alternativen profitieren.
Durch Cashare erhalten Darlehensgeber die Möglichkeit, im Rahmen des social lendings konkrete Darlehensprojekte zu finanzieren und Menschen direkt zu unterstützen. Darlehensgeber können Darlehen nach ihren eigenen individuellen und sozialen Kriterien vergeben.
Cashare bietet eine faire und sichere Abwicklung der Transaktionen an und nimmt gesetzlich notwendige Prüfungen vor, damit Darlehensgeber und Darlehensnehmer ihre Darlehensgeschäfte in einem gesicherten Umfeld abschliessen können.
|
Die Sendung ECO von SF vom 11.10.2010 zeigt, wie Cashare funktioniert. ECO vom 11.10.2010 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität Basel: Tipps & Tricks
 |

Universität Basel: Die älteste Universität der Schweiz
Die Universität Basel zählt derzeit etwas über 11.000 Studierende. Der Schwerpunkt der Alma Mater liegt auf den Bereichen Kultur und Life Sciences. Unter Life Sciences, einem Begriff aus dem angelsächsischen Raum, werden die Wissenschaften verstanden, die sich mit Prozessen und Strukturen von Lebewesen befassen: beispielsweise Medizin, Biologie, Biophysik oder Biomedizin. Doch Basel deckt mit sieben Fakultäten und 70 zugeordneten Instituten alle klassischen und auch modernen Studiengänge in Form von Bachelor-Studien, Master-Studien und eventuell auch Doktoraten ab. Bei der Universität Basel handelt es sich um eine eher kleine Universität, die Kontaktmöglichkeiten zu Lehrenden und anderen Studierenden bietet. Mit 100 Jahren Bestehen handelt es sich um eine traditionsreiche Universität, wo noch die sogenannte akademische Freiheit gepflegt wird. Der Studienerfolg hängt massgeblich von den Studierenden, ihrer Motivation und ihrem Organisationsvermögen ab. Die Universität hat jedoch diverse Rahmenbedingungen geschaffen, um hilfreich zur Seite zu stehen. Die wichtigsten Tipps, um an der Universität Basel zurechtzukommen und die wichtigsten Anlaufstellen finden Sie im Folgenden.
Von: Marijana Babic
Anmeldung und Zulassung
Fristen für die Anmeldung inländischer und ausländischer Studierender finden sich unter http://www.unibas.ch/index.cfm?uuid=E84B62CAEBBEB7C552B799E7693FFC6E. Allgemein zuständig ist das Studentensekretariat. Immatrikulationen für das Herbstsemester sind möglich vom 9. August bis 10. September jeweils von 9.30 bis 14.00 Uhr. Erforderlich ist persönliches Erscheinen und eine Ausweisung. Die Einschreibung erfolgt im Studentensekretariat, im Kollegienhaus der Universität am Petersplatz 1. Mitzubringen sind der Personalausweis und die Maturitätsbescheinigung. Die Telefonnummer lautet: +41 (0)61 267 30 23. Es ist angeraten, sich frühzeitig anzumelden. Ausländische Studierende können sich zu den gleichen Zeiten anmelden. Sie müssen ihren Zulassungsbescheid vorlegen sowie Belege, dass sie eventuelle Prüfungen (etwa Freiburger Prüfung um das Maturitätsniveau zu belegen) bestanden haben. Nicht alle ausländischen Zeugnisse werden anerkannt. Manchmal ist eine Zusatzprüfung vonnöten. Bei der Anmeldung sind der Personalausweis und die Zulassungsberechtigung mitzubringen. Ausländische wie inländische Studienanfänger erhalten im Anschluss den Studierendenausweis sowie zwei Studienbescheinigungen ausgehändigt. Ausländische Studierende müssen Tickets ziehen und werden anschliessend aufgerufen. Das persönliche Erscheinen des Aspiranten ist unbedingt erforderlich. Die Semestergebühren betragen 700 CHF. Deren Bezahlung muss vor der Immatrikulation ebenfalls nachgewiesen werden.
Fachliche Hilfe: Umfassende Studienberatung
Um mit einem komplexen Studium wie dem Bachelor zurechtzukommen, ist Information das A und O. Die Universität Basel ist bezüglich dieser Wissensvermittlung für Studienanfänger sehr gut aufgestellt. Die Studienberatung befindet sich im Steinengraben 5 in Basel. Kontakt: Telefon +41 (0)61 267 29 29/30, Fax +41 (0)61 267 29 34, E-Mail: studienberatung@unibas.ch. Die Studienberatung hat auch eine eigene Website: www.studienberatung.unibas.ch. Angeboten werden Infogespräche zu Studienwahl, Studium und Berufsmöglichkeiten. Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich. Als Service listet die Studienberatung auf ihrer Website alle Fächer, die an der Universität Basel studiert werden können, mit ausführlichen PDF-Dateien zu Anforderungen und Leistungsnachweisen. Online bietet die Studienberatung zudem eine virtuelle Infothek an: www.studienberatung.unibas.ch/studieninformation/virtuelle-infothek/ Die Studienberatung bietet ausserdem eine umfangreiche Broschüre „Basler Studienführer“ an, in der alle möglichen Fragen angesprochen werden: Passen bestimmte Studienkombinationen? Bin ich im richtigen Fach? Wie sieht das Medizinstudium in Basel aus? Kann ich ein Doppelstudium machen? Bestellt werden kann er per E-Mail an studienberatung@unibas.ch. Der Studienführer wird dann per Post versandt. Es ist sicher sinnvoll, zunächst den Studienführer zu lesen und erst dann mit den noch offenen Fragen in die Beratungsstelle zu kommen. Besonderer Service der Studienberatung: Besuchsprogramme Für alle, die sich für ein Studium an der Universität Basel interessieren, gibt es so genannte Live-Programme. Die Studienberatung stellt während der Semester (September bis Ende Dezember und Februar bis Ende Mai) für jeden Aspiranten ein eigens auf ihn zugeschnittenes Besuchsprogramm zusammen. Dazu gehören z. B. in Vorlesungen reinschnuppern, Führungen, Bibliotheksbesichtigungen und mehr. Kontakt: markus.diem@unibas.ch. Allgemeiner Informationstag am 12. Januar 2011 von 10.00 bis 17.00 Uhr. Alleine 400 Veranstaltungen einzelner Studienfächer werden an diesem Tag angeboten. Kontakt mit Lehrenden und Studierenden ist möglich, ausserdem gibt es Information rund um das Studium an der Universität Basel: Studiengestaltung, Abschlüsse, Berufsaussichten. Aufgrund der Notwendigkeit von Planung und Organisation sollten sich Interessierte bei markus.diem@unibas.ch anmelden und auch angeben, welche Fächer für sie interessant sind. Bis Dezember 2010 wird dann ein Programmheft mit einem Gutschein für ein von der Universität angebotenes Mittagessen zugeschickt. Ausserdem erhält man eine Tageskarte zur Benutzung der Basler Verkehrs-Betriebe. Selbstverständlich steht die Studienberatung auch für die Planung und Fragen rund um das Management des Studiums zur Verfügung. Die Einrichtung verfügt auch über eine Infothek mit Materialien zu Studium, Berufswahl und Weiterbildung.
Berufs- und Studienberatung Baselland
Alternativ gibt es auch die Berufs- und Studienberatung Baselland, die allerdings weniger den Schwerpunkt auf Studienfächer legt, sondern eher auf Berufsmassnahmen. Sie befindet sich in der Wuhrmattstrasse 23 in Bottmingen oder in der Rosenstrasse 25 in Liestal. Telefonkontakt: +41 (0)61 426 66 66 oder +41 (0)61 927 28 28. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00. Webadresse: www.afbb.bl.ch. Weitere Informationsangebote Pro Studienrichtung ist mindestens ein Dozent/eine Dozentin verpflichtet, Studienfachberatungen für Studierende anzubieten. Was erwartet mich im Studium? Wie kann ich mein Studium am besten gestalten? Wie sehen die Leistungsnachweise aus? Für all diese Fragen ist der Studienfachberater da. Ausserdem bieten alle Lehrenden Sprechstunden nach Vereinbarung an bzw. je nach aktueller Meldung, die den Aushängen zu entnehmen sind. Die meisten Fächer bieten ausserdem Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger an. All diese Möglichkeiten sollten genutzt werden. Je besser informiert der Studienanfänger ist, umso erfolgreicher ist in der Regel sein Studium. Oder: Der Betreffende kommt zu dem Entschluss, dass er oder sie im falschen Fach gelandet ist. Ausreichend mit Informationen bestückt kann es losgehen. Das Vorlesungsverzeichnis, um gleich die passenden Kurse auszuwählen, gibt es online unter http://www.unibas.ch/index.cfm?uuid=5F00F1E802FF0FD023FE093A5AE1875E&&IR.... Die wichtigsten Adressen, die im Laufe eines Studiums gebraucht werden könnten, finden Sie hier: http://www.unibas.ch/index.cfm?uuid=5ECA031A0B2F06328648DDC1C4442458&&IR... - vom Universitätssport über die Auskunft bis zur Öffentlichen Bibliothek Basel. Vorsicht: Leistungsanrechnung Kreditpunkte werden nur anerkannt, wenn deren Bewilligung beantragt wird. Der Dekan der Fakultät entscheiden dann, ob die Credits im Sinne des Leitbildes der Universität Basel sind. Falls Credits anerkannt werden, geht ein Bescheid ein.
Die Universitätsbibliothek – ein entscheidender Mosaikstein
Die Motivation ist da, Fleiss und Ausdauer auch, alle nötigen Informationen wurden eingeholt. Nun ist noch die Frage, mit welchen Mitteln ein Studium massgeblich gestaltet werden kann. Zum Studieren wird Fachliteratur benötigt, manchmal auch ausgefallene, und die gibt es in Basel in der Öffentlichen Bibliothek. Die Recherche ist dabei recht einfach unter http://aleph.unibas.ch/F. Drei Millionen Titel stehen dabei zur Verfügung. Hinzu kommt die Universitätsbibliothek Basel im Verbund mit weiteren 190 Bibliotheken, die unterschiedlichste Schwerpunkte haben. Für Handschriften gibt es ein gesondertes Verzeichnis unter http://aleph.unibas.ch/F?con_lng=GER&func=file&file_name=ibb-archives. Bei Fragen und Schwierigkeiten hilft die Auskunft, die im Katalogsaal im ersten Obergeschoss präsent ist. Sie hilft bei Literaturrecherchen, die mitunter knifflig sein können, Dokumentenarchivierung, bei Fragen zur Benutzung, organisiert Fernleihen, nimmt Kopieraufträge entgegen und bietet vor allem auch Führungen und Schulungen an. Welcher Studienanfänger fühlt sich nicht von drei Millionen Bänden erschlagen? Die Führungen und Schulungen sind dabei nach allgemeinen Themen und nach Fakultäten gestaffelt, um optimale praxisbezogene Wissensvermittlung zu erreichen. Termine und Uhrzeiten erfährt man unter http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/dienstleistungen/schulungen-v.... Jeder Studienanfänger sollte diese Angebote nutzen, um den optimalen Start ins Studium zu haben. Denn: Eifer braucht Informationen und Informationen gibt es hauptsächlich in der Bibliothek. Die Universitätsbibliothek befindet sich in der Schönbeinstrasse 18-20 in Basel. Telefon Auskunft: +41 (0)61 267 31 00, E-Mail: info-ub@unibas.ch. Die Anfahrt gelingt am besten mit der BVB Tram 3, dem BVB Bus 30 und dem BVB Bus 33.
Studentische Netzwerke: Studenten helfen Studenten
Soziale Kontakte, die natürlich auch im Studium behilflich sind, findet der Studienanfänger unter anderem in den studentischen Organisationen, die an der Universität Basel so schillernd bunt wie die Welt der Gedanken ist. Von Patrioten bis zu Freizeitsportlern finden Sie hier die gesamte Bandbreite an Gruppen: http://www.unibas.ch/index.cfm?5F1CFEA299299E3420FA12DD4862B93A. Unbedingt Kontakt aufzunehmen ist mit den jeweiligen Fachschaften. Sie helfen inhaltlich und sozial weiter. Sie sind die direkten Ansprechpartner bei Problemen und auch bei vielen fachlichen Fragen. Eine wichtige Adresse ist ebenso http://www.students.ch, eine in der ganzen Schweiz vertretene Plattform, wo sich Studierende austauschen und gegenseitig wertvolle Tipps geben. Studienbeginner sollten daher immer auch über diese Möglichkeiten der Kommunikation auf dem Laufenden sein.
|
Skuba Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Wie sinnvoll sind Referate?
 |

Ein Seminar ist spannend, gibt viele Kreditpunkte, und birgt etwas in sich, das dem einen widerstrebt und dem anderen eine wahre Freude bereitet: ein Referat zu halten. Ein Thema aufzuarbeiten und zu präsentieren bedeutet viel Aufwand, aber auch eine Gelegenheit, einen bestimmten Sachverhalt von Grund auf kennenzulernen. Doch manchmal verkommen Referate zu einer Alibiübung. Ein Kommentar von Salomé Blum über den Sinn von Referaten an Schweizer Hochschulen.
Von: Salomé Blum
Der Moment nach dem Referat ist der schönste: das Gefühl, es überstanden zu haben. Die Angst, vor den Mitstudierenden und dem Dozenten zu stehen und ein Thema vorzustellen, überschattet meist die guten Seiten, die ein Referat haben kann. Ein Thema aufzurollen, die wichtigen Punkte herauszulösen und in knapper Zeit verständlich zu präsentieren, während man in meist gelangweilte Gesichter der Mitstudenten schaut, ist nicht nur eine Herausforderung. Es ist auch eine gute Möglichkeit, sich in ein bestimmtes Gebiet weiter zu vertiefen, mehr Wissen anzusammeln und zu lernen, wie sich ein Thema spannend präsentieren lässt. Referieren bedeutet auch die Gelegenheit, die meist unbegründete Angst abzulegen, vor den Mitstudenten wie ein Affe dazustehen. Nicht immer jedoch bieten Referate dieselben Chancen. Sie reichen von fünfminütigen Einführungen bis zu Mordsvorträgen, die eine ganze Doppellektion füllen müssen. Dass der Aufwand sehr stark variiert, ist klar. Dass die Kreditpunkte nicht dem Arbeitsaufwand entsprechend vergeben werden, ist auch klar. Ein kleiner Überblick zu Referaten in einigen Studienfächern der Schweizer Hochschulen:
Alibiübung oder Chance?
In der Biologie ist ein Referat ein Werbespot: Die Biostudierenden lernen dabei, ein Paper zu verkaufen – ein erster Grundstein, um später eine Stelle zu finden, Leute vom eigenen Projekt zu überzeugen. In den philologisch-historischen Studiengängen werden viele Referate verlangt, mal kurze, mal stundenfüllende, bei denen die Studierenden häufig auch eine Diskussion leiten müssen. Manchmal springt der Dozent ein und führt die Diskussion. Anders ist es im Jusstudium: Natürlich ist das Bild des Anwalts, der grosse Reden vor dem Geschworenengericht schwingt und es im Schlussplädoyer im letzten Augenblick von der Unschuld seines Mandanten überzeugen kann, stark von Hollywoodfilmen geprägt. Doch auch in der Realität ist ein Anwalt hin und wieder im Gericht und referiert. Üben das die Jusstudierenden? Nein. In keinem anderen Studiengang scheinen Referate so wenig verbreitet zu sein wie im Jus. Doch gerade für diese Studierenden wären Referate für die spätere Berufspraxis und auch für die Anwaltsprüfung bestimmt sehr nützlich. Es wäre also keine schlechte Idee, die Chance zu bekommen, während des Studiums seine etwaige Angst vor Vorträgen abzulegen. Der Studiengang ist somit institutionell falsch aufgebaut.
Rückmeldungen wären sinnvoll
In Psychologieseminaren sitzt der Dozent leider allzu häufig nur da, macht sich Notizen und lässt die Studierenden die Arbeit erledigen. Eine nette Art, sich sein Geld zu verdienen, ist das allemal. Aus Studierendensicht ist es jedoch eine verpasste Gelegenheit, nicht vom grossen Wissen des Professors profitieren zu können. Natürlich lässt sich argumentieren, dass die Studierenden durch das Hineinknien in ein Thema sehr viel mitnehmen können. Doch bleibt es ohne Diskussionen, ohne Kritik, ohne Gegenargumente des Dozenten, der sich eigentlich in diesem Bereich auskennen sollte, bleibt auch der Profit von Referaten auf der Strecke. Dasselbe gilt für das Feedback des Dozenten zur Art des Referierens: Was war gut, was schlecht, was sollte verbessert werden? Sind solche Feedbacks häufig? Leider nicht. Genauso herrscht auch wenig Transparenz in der Notengebung. Am Ende eines Seminars steht eine Note – doch wie setzt sie sich zusammen aus Prüfung, schriftlicher Arbeit, Referat und mündlicher Teilnahme? Um dies in Erfahrung zu bringen, müssten die Studierenden Eigeninitiative entwickeln, eine Eigenschaft, welche im Bolognasystem nicht gerade grossgeschrieben wird. Doch gerade hier würde sich ein wenig Aufwand lohnen. So könnten die Studierenden lernen, was sie eventuell verbessern könnten. Dennoch stellt sich die Frage: Wieso geben nicht alle Dozenten den Referierenden ein (kurzes) Feedback? Vielleicht ist ihnen der Aufwand zu gross. Doch: Sind wir nicht an der Uni, um etwas zu lernen? Und sind die Dozenten nicht an der Uni, um uns etwas zu lehren?
Genau wie bei der Variation der Referate und der Punkteverteilung gibt es auch unterschiedliche Qualität bei den Referaten. Für die einen sind sie ein Gräuel, für die anderen ein Moment, auf den sie lange hinfiebern. Aus Freude, weil sie gerne vor anderen stehen und etwas erzählen können, was sie sehr interessiert. Diese Studierenden sind dann in ihrem Element, sie haben Spass am Recherchieren, am Zusammenstellen, am Referieren, am Erklären. Nicht zuletzt können dadurch Profs auf Studierende aufmerksam werden, wenn sie an die Vergabe von neuen Hilfsassistenten- oder Doktoratstellen denken.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Studieren in Südafrika
 |

Afrikanische und westliche Kultur, Schwarze und Weiße: Das akademische Angebot in Südafrika ist ebenso bunt wie das Land selbst. Die Universitäten im Kap-Staat bieten ein komplettes Fächerspektrum von Design über Geisteswissenschaften bis Naturwissenschaften. Wer an der Universität von Kapstadt studieren kann, ist privilegiert.
Von: Hanni Heinrich
Der junge schwarze Mann schiebt seine etwas zu groß geratene Brille mit dem Zeigefinger die Nase hoch und drückt sie fest ins Gesicht. Er sitzt in der Kapstädter Universitätsbibliothek über einem Buch, das er für sein Studium lesen muss: Afrikanische Literatur. Mxolisi Malimela ist 26 Jahre alt, studiert an der University of Cape Town (UCT) und ist stolz darauf: Akademisch gehört die UCT zur ersten Garde und ist in den meisten Fächern zusammen mit der Universität Stellenbosch führend – beides sind nach wie vor die Kaderschmieden, wie man sie aus Apartheidszeiten kannte. „Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei“, sagt Mxsolisi, denn sonst dürfte er gar nicht an der UCT studieren. Die UCT gilt immer noch als Eliteuniversität, bis 1994 war sie nur für Weiße bestimmt. Heute lernen dort Studenten aus ganz Afrika. Dabei studieren hier nicht nur junge Erwachsene aus reichen Elternhäusern: Irgendwie bringen afrikanische Familien immer Mittel auf, um talentierte Jugendliche zur Uni zu schicken. So ist es auch bei Mxolisi Malimela: Er bekam wegen seiner guten Schulnoten ein Stipendium von einer privaten Organisation. Ursprünglich stammt Mxolisi aus einem Dorf bei Johannesburg. Er wuchs dort in bescheidenen Verhältnissen auf und besuchte die Dorfschule. Seine Eltern sind Arbeiter in einem Supermarkt und durften nie studieren. Sie sind stolz auf ihren Sohn. Mxolisis Muttersprache ist Xhosa– aus seinem traditionellem Stamm, erst in der Schule lernte er Englisch.
Kapstadts Uni bietet Lifestyle und Renommee
Der motivierte Schüler absolvierte bereits Kulturwissenschaften mit einem Bachelorabschluss an der UCT, doch das reichte ihm nicht. „Ich wollte mich auf ein Masterstudium in Afrikawissenschaften konzentrieren, und weil die UCT einen sehr guten Ruf auf dem gesamten afrikanischen Kontinent hat, blieb ich in Kapstadt.“ Er kannte die Stadt durch sein Erststudium und die Chance, an dieser renommierten Universität einen Master zu absolvieren, wollte er sich nicht entgehen lassen. „Kapstadt passt zu meinem Lifestyle“, sagt Mxolisis. Kulturell bietet Kapstadt alles, was eine internationale Metropole bieten kann: „Theater, Kino und viel Jazz finde ich so gut wie jeden Tag hier, da muss ich mich manchmal zusammenreißen, sonst würde ich fast täglich ausgehen“, erzählt Mxolisi und grinst dabei. „Die UCT hat darüber hinaus ein Center für Afrikastudien (CAS) und eine sehr gut sortierte Bibliothek. Ich finde hier fast alles zu afrikanischer Literatur und Kultur.“ Weil die UCT Austauschprogramme mit Harvard und anderen renommierten Universitäten der USA und Europas unterhält, können die Studenten interessante Kontakte knüpfen. Mxolisi Malimela nutzte diesen Vorteil: „Für mich war es wichtig, auch mal von außen den afrikanischen Kontinent zu betrachten. Also von einem anderen Kontinent aus.“ Als er erfuhr, dass die Universität Basel auch ein Afrika-Zentrum hat, ergriff er sofort die Gelegenheit und nahm am Studentenaustausch zwischen der Uni Kapstadt und der Uni Basel teil. Das Büro für den internationalen akademischen Studentenaustausch fördert motivierte Studenten, und so schickte die Universität Kapstadt Mxolisi nach Basel. Voraussetzung ist neben guten Noten, dass die Studenten anschließend zurück nach Südafrika gehen und den Nachwuchsakademikern Mut machen.
Ein Xhosa in Basel
Der Xhosa aus einem kleinen Dorf bei Johannesburg bekam also das Stipendium und flog in die Schweiz nach Basel. Diese Chance ist etwas Besonderes unter seinen Kommilitonen in Kapstadt. „Es wäre noch praktischer für mich gewesen, wenn ich in einem englischsprachigen europäischen Land gewesen wäre, aber die Kurse und Seminare für Afrikawissenschaften sind in Basel auch auf Englisch. Ich wollte einfach die Chance nutzen, nach Europa zu kommen, egal wohin“, so Mxolisi , der ein Semester an der Universität in Basel verbrachte. Schnell freundete er sich mit dem kulturellen Angebot der Stadt an: „Ich mag das Theater und die Konzerte“, erzählt er, während er sich an seinen Auslandsaufenthalt erinnert. „Die Menschen habe ich als sehr zurückhaltend wahrgenommen, ruhiger als die Kapstädter; mit einigen Schweizern bin ich jetzt befreundet, obwohl ich zuerst dachte, sie seien so zurückhaltend, weil ich schwarz bin.“ Was ihn am meisten an der Schweizer Uni beeindruckt ist, dass sich Studenten aus dem Grundstudium auch für Kurse im Hauptstudium anmelden und hinein schnuppern dürfen. Noch heute gehört Südafrika weltweit zu den Ländern mit den größten Unterschieden zwischen arm (in der Regel schwarz) und reich (in der Regel weiß). Wer an der UCT offen ist und vielleicht mal mit etwas Kleingeld für Fotokopien oder ein Mittagessen aushilft, macht sich schnell Freunde. „Es tun sich Welten auf, wenn man das Leben der Schweizer Studenten und das der schwarzen Studenten in Kapstadt vergleicht“, sagt Mxolisi. Die Unterschiede zwischen schwarz und weiß sind in Südafrika noch zu spüren – auch an der renommierten Uni in Kapstadt, wo noch heute nicht selten „schwarze“ und „weiße“ Tische in der Mensa zu sehen sind.
Bunt gemischt
An der University of Western Cape (UWC) in Bellville, etwa 30 Kilometer östlich von Kapstadt, studiert Mxolisi Malimelas Freund Pshasha Seakamela. Der 30-Jährige absolviert ebenfalls einen Master, allerdings in Medienwissenschaften. Diese Universität zählt nicht zur Elite. Dennoch ist sie gut besucht und bei Südafrikanern beliebt: bei den Farbigen – also den Mischlingen – ebenso wie bei den Schwarzen. Die UWC engagierte sich als eine der wenigen Unis, ein demokratisches Südafrika aufzubauen. Während der Apartheid wurde die Universität des Westkaps 1959 für die Ausbildung von Schwarzafrikanern gegründet. Heute hat sie eine sprachlich und ethnisch gemischte Studentenschaft. „Hier sind die Tische bunt“, sagt Pshasha und schmunzelt. „Das ist anders als an der Universität in Kapstadt“. An der UWC entwickelten sich Anti-Apartheitsgruppen, Farbige und Schwarze kämpften gemeinsam gegen die Regierung. Heute gilt die Universität des Westkaps als modern und für die Regenbogennation vorbildlich und aufstrebend.
Gute Dozenten, schlechte Ausstattung
Pshasha kann leider keinen Auslandsaufenthalt wahrnehmen: „Ich arbeite nebenbei, um mir mein Studium zu finanzieren. Die UWC hat auch viele Kontakte zu anderen Unis, aber nur wenige Plätze in Europa.“ Früher bot die UWC nur wenige Studiengänge für mittlere Positionen im öffentlichen Dienst und an Schulen an. Doch in den letzten zehn Jahren entwickelte sie sich zu einer internationalen Bildungsanstalt mit spezialisierten Studiengängen in Recherche, Bildung und Software Solutions. Die UWC hat gute Dozenten, aber in der Ausstattung ist sie weniger gut bestückt als die Uni in Kapstadt. „Wie sollen die Leute Biologie ohne Mikroskope und Geografie ohne Karten und Atlanten lernen?“, fragt Pshasha Seakamela. „Das sind die kleinen Unterschiede zwischen den Universitäten am Kap.“
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität St. Gallen: Tipps & Tricks
 |
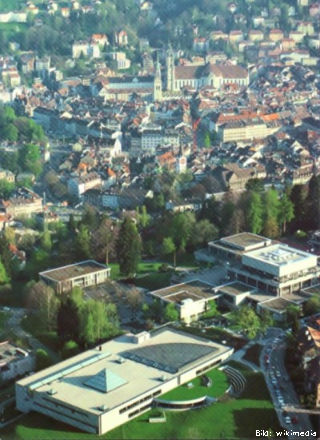
Über 100 Jahre Erfahrung und rund 7700 Studierende – die Universität St. Gallen gilt als eine der besten Wirtschaftsuniversitäten in Europa. Der Akzent liegt klar auf den wirtschaftlich-juristischen Fächern, obwohl auch Kulturwissenschaften studiert werden können. Der kleine und überschaubare Rahmen in Kombination mit geballter Kompetenz in wirtschaftlich-juristischen Belangen macht die Universität für Studierende attraktiv, die genau wissen, was sie wollen. Auch hier gliedert sich das Studium gemäss der Bologna Reform in Bachelor, Master und eventuell einem Doktorat. Neben rein fachlicher Wissensvermittlung ist die Universität eng verzahnt mit praktischer Anwendung. Know-how mit Praxisbezug: Alles Wichtige, um das Studium in St. Gallen zu einem Erfolg werden zu lassen, findet der Studieninteressierte komprimiert in den folgenden Abschnitten.
Von: Marijana Babic
Zur Einführung: Studien-Schnuppertage
Die Universität St.Gallen unterbreitet ihr Modell bei den Infotagen für Maturanden und beim Jus-Schnuppertag. Ausserdem gibt einen Master-Infotag. Die Fachrichtungen präsentieren sich dabei, auch Fragen können gestellt werden und Kontakte geknüpft. Die aktuellen Daten sowie die Programme sind unter folgendem Link einsehbar: www.infotag.unisg.ch
Immatrikulation und alles was dazugehört
Bachelor-Studium: Voraussetzung ist die Schweizer Matura oder ein gleichwertiger ausländischer Abschluss. Für ausländische Studierende (sofern ihr Zeugnis anerkannt ist) gelten Zulassungsbeschränkungen. Es ist erforderlich, einen Zulassungstest zu absolvieren. Das erste Jahr eines Bachelor-Studiums nennt sich dabei Assessmentjahr. Dieses kann komplett in Deutsch oder Englisch absolviert werden. Anschliessend stehen 5 Vertiefungsrichtungen (Majors) zur Auswahl. Die Anmeldefrist für ein Bachelor-Studium ist vom 1. Februar bis 30. April. www.zulassung.unisg.ch
Master-Studium: Viele der 13 Master-Programme haben spezifische Aufnahmekriterien. Die Anmeldefristen sind für das Herbstsemester vom 1. Februar bis 30. April und für das Frühjahrssemester (Eintritt nur bei wenigen Programmen möglich) vom 1. September bis 30. November. Infos zur Anmeldung und Zulassung finden Sie unter www.zulassung.unisg.ch
Bibliothek – Wissen für alle
Über 600'000 Bücher, Zeitschriftenbände und Non-Books (DVDs, Hörbücher, CDs), mehr als 120'000 E-Books und 30'000 lizenzierte Fachzeitschriften stehen unseren Studierenden und Dozierenden, aber auch der Öffentlichkeit, in der Bibliothek zur Verfügung.
Unsere Bibliothek ist eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Sie ist öffentlich zugänglich und sammelt Informationsträger zu Wirtschafts-, Rechts-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Sie können die benötigten Dokumente am Regal holen und an den Arbeitsplätzen damit arbeiten bzw. auch selbst ausleihen. Die Benutzung der Bibliothek und die Ausleihe sind kostenlos.
Neben wissenschaftlichen Dokumenten auch Belletristik
Neben wissenschaftlichen Dokumenten und Informationsquellen für Lehre, Forschung und Studium hält die HSG-Bibliothek auch eine gut dotierte Abteilung mit sprach- und literaturwissenschaftlichen Werken, eine Belletristiksammlung, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften allgemeinen Inhalts und sogar eine kleine, aber feine Comic-Sammlung für alle interessierten Leserinnen und Leser bereit.
Öffnungszeiten
Unsere regulären Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 23.00 sowie Samstag 9.00 bis 19.00 Uhr.
Vorlesungsfreie Zeit (Kalenderwochen 27-37): Montag bis Freitag 9.00 bis 20.00 sowie Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr.
Weitere Infos unter www.biblio.unisg.ch
Praxisorientierte Forschung – die Grundlage für Lehre und Weiterbildung
Die Universität St. Gallen ist stark forschungsorientiert. Der Akzent liegt auf der Praxisnähe, um problemorientierte Lösungen für Fragen (zum Beispiel Überalterung der Gesellschaft) anbieten zu können. Ein innovatives Modell an der Universität St. Gallen verteilt die Forschungsprojekte auf die jeweiligen Institute, die wiederum relativ eigenständig sind. Auf diese Weise sind Forschung und Lehre eng miteinander verzahnt. Es ist für Studienanfänger, die sich vorstellen können, im Bereich der Forschung tätig zu werden, auf jeden Fall hilfreich, frühzeitig den Kontakt zu Lehrenden zu suchen und in welcher Funktion auch immer bei Forschungsprojekten mitzuarbeiten.
|
Austauschprogramme – weltweit spezialisierte Partneruniversitäten Detaillierte Infos unter www.exchange.unisg.ch Studentische Projekte wie die Absolventenmesse «HSGtalents», das international renommierte «St.Gallen Symposium» (ISC) oder «oikos - students for sustainable economics and management» prägen das Bild der HSG. Sie alle werden von Studierenden parallel zum regulären Studium auf die Beine gestellt. Organisiert in über 100 Vereinen und Initiativen, Projekt-Teams oder der Studentenschaft arbeiten Studierende an der Verwirklichung ihrer Ideen und gestalten die Universität mit. Viele sind bereit, hart dafür zu arbeiten und einen Grossteil ihrer Freizeit in ihr Projekt zu investieren. Praktische Erfahrungen, unvergessliche Erlebnisse Dieses Engagement zahlt sich zwar nicht im monetären Sinne aus, bereichert aber die Studienzeit durch praktische Erfahrungen, unvergessliche Erlebnisse und zahlreiche Freundschaften. Die Universität fördert dieses Engagement nicht zuletzt durch Campus Credits, die unter bestimmten Voraussetzungen konventionelle Lehrveranstaltungen ersetzen können. Für den Umzug nach St. Gallen empfehlen sich statt Bananenschachteln oder Umzugskartons die praktischen Miet-Mehrweg-Faltboxen von LeihBOX.com .
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der ETH Zürich: Tipps & Tricks
 |

ETH Zürich - stark in Technik, Naturwissenschaften und Forschung. Von A wie Architektur bis Z wie Zulassung: Bereits die Website der ETH Zürich – der Eidgenössischen Technischen Hochschule – bietet allerlei Wissenswertes für Studienanfänger und auch andere, die ihr Studium erfolgreich an der international renommierten Hochschule erfolgreich zu Ende bringen wollen (http://www.ethz.ch/). Insgesamt 23 Bachelor und 39 Masterfächer werden hier angeboten, die Zahl der Doktoranden ist wegen der gezielten Ausrichtung auf Forschung mit 40 Prozent sehr hoch. Aufgrund des alten Namens „Eidgenössisches Polytechnikum“ aus dem Gründungsjahr 1855 ist für die ETH liebevoll der Spitzname „Poly“ geblieben.
Von: Marijana Babic
Im Angebot sind Studiengänge in Architektur und Bauwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik, systemorientierte Naturwissenschaften und Management und Sozialwissenschaften – Technik und Naturwissenschaften also. Dies ist ein breites Angebot für spezialisierte Fachausrichtungen. Die sehr übersichtliche Website der ETH ist benutzerfreundlich und weist beispielsweise die möglichen Fächer unter http://www.ethz.ch/prospectives/programmes mit Links zu allen Ansprechpartnern auf.
Derzeit nehmen 16.000 Studierende aus insgesamt 80 Ländern das Angebot der ETH Zürich wahr, wobei der besondere Ruf der Einrichtung als europäisches Parademodell einer Forschungs-Universität sicher zu deren Resonanz beiträgt. Die Gebäude der Hochschule verteilen sich dabei auf zwei Standorte: zum einen im Zentrum der Stadt Zürich, ausserdem am Hönggerberg, der ausserhalb des Stadtzentrums liegt. Insbesondere der Hönggerberg wird seit den 1970er Jahren vermehrt unter dem Slogan „Science City“ ausgebaut. Er kann mit den Buslinien 37, 80 und 69 sowie mit zwei Shuttle-Linien direkt vom Zürcher Hauptbahnhof und vom Hauptgebäude der ETH erreicht werden.
Die ETH: Für Techniker, Naturwissenschaftler und ambitionierte Forscher
Der Vorteil der ETH Zürich: Fundierte Wissensvermittlung durch hervorragende Fachleute, die in internationalen Kreisen anerkannt sind und auch gezielt angeworben werden. Dies alles gibt es in einem recht überschaubaren Rahmen, der kleinere Gruppenbildungen und Arbeitsgemeinschaften erlaubt. Die ETH bemüht sich dabei nicht nur um hervorragende Forscher (21 Nobelpreisträger sind hier hervorgegangen, unter anderem Albert Einstein), sondern auch um talentierten Nachwuchs, der bestens betreut wird. Näheres dazu wird noch ausgeführt. Es handelt sich auf jeden Fall um eine streng wissenschaftlich ausgerichtete Hochschule, die ihren Studierenden einiges abverlangt – aber auch einiges bietet.
Im Folgenden werden alle Punkte gelistet, die Fragen beantworten wie: Wie ist ein Studium an der ETH aufgebaut und wie melde ich mich an? Wo finde ich fachliche Beratung für die Bewältigung des Studiums? Wo finde ich alle wichtigen Einrichtungen und wie gehe ich damit um? Alles Fragen, deren Beantwortung helfen soll, sich schnell an der ETH zurechtzufinden und erfolgreich und zügig sein Studium zu absolvieren.
Wie ist das Studium aufgebaut?
Nach der Bologna-Reform, die vor zehn Jahren stattfand, wurden sämtliche Studiengänge auf Bachelor, Master, Doktor bzw. Master of Advanced Studies oder Master of Business Administration umgestellt. Diesem Modell folgt auch die ETH. Erworben werden müssen Credits, die in Form von Leistungen wie Referaten, Hausarbeiten oder einfach Teilnahme an Veranstaltungen erworben werden. Für ein Bachelor-Studium sind 180 Credits erforderlich, für den Master zusätzliche 120.
Wie schreibe ich mich ein?
Unter http://www.ethz.ch/prospectives/admission sind Fristen und Ansprechpartner nach Fächern für Anmeldewillige gelistet. Für Studienanfänger interessant: Mit einer Schweizer Matura ist eine direkte Bewerbung bei der Rektoratskanzlei möglich, deren Positivbescheid den Studienbeginn erlaubt. Bei einem anderen Reifezeugnis prüft die Zulassungsstelle, ob dieses dem Schweizer Standard angemessen ist. Dabei kann gegebenenfalls eine Aufnahmeprüfung auf Maturitätsniveau anstehen. Wird diese erfolgreich absolviert, steht dem Studium nichts mehr im Wege. Hat ein Student an einer anderen Universität oder in einem vergleichbaren Fach bereits 120 credits erreicht (180 sind per Leistungsnachweisen für ein Bachelor-Studium erforderlich) kann er sich ebenfalls an die Zulassungsstelle wenden und eine Aufnahme beantragen. Die Zulassungsstelle der ETH Zürich befindet sich in der Rämistrasse 101 in Zürich und ist montags bis freitags von 11.00 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Lageplant gibt es hier: http://www.rektorat.ethz.ch/de_location.jpg?hires. Anmeldefristen und -termine sind unter http://www.ethz.ch/prospectives/admission zu finden.
Ausländische Studierende
Neben der erstgenannten Gruppe, die über keine Schweizer Matura verfügen, gibt es auch Studenten von Partneruniversitäten, die das Recht haben, ein bis zwei Semester an der ETH zu studieren (und umgekehrt). Das Netzwerk der ETH an Partneruniversitäten umspannt sich dabei weltweit. Für Nicht-Mitglieder besteht eine Möglichkeit für ein Gaststudium. Studenten der ETH sollten dieses Kooperationsnetz nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, wie in anderen Ländern (etwa den USA) geforscht und gelehrt wird. Dies kann den Absolventen später auch zu einer internationalen Karriere qualifizieren, vom Vorteil des Spracherwerbs ganz abgesehen. Denn insbesondere ein Wissenschaftler muss auch räumlich flexibel sein.
Maturanden und Schüler: Schnuppertage und Einführungen Studieninformationstage
Die ETH Zürich bietet vor jedem Semesterbeginn Studieninformationstage an. Dabei werden Studiengänge und Lehrende vorgestellt, Probevorlesungen abgehalten und die ETH stellt sich als Gesamteinrichtung vor. Diese Veranstaltung sei jedem empfohlen, da sie einen guten Einblick bietet. Die neuesten Termine gibt es immer unter http://www.soc.ethz.ch/orientation/informationstage.
Schnupperkurs Informatik für Frauen
Eine Woche lang können sich weibliche Interessierte hier ausführlich in die Thematik einführen lassen. Mit dabei ist zum Beispiel eine Einweisung ins Programmieren. Der nächste Schnupperkurs findet vom 7. Bis zum 11. Februar 2011 statt. Anmeldung ist möglich unter http://www.frauen.inf.ethz.ch/schulis/sstud/anmeldung. Ziel ist es, vermehrt Frauen und Mädchen für den Studiengang und für die ETH Zürich im Allgemeinen zu interessieren. Studienwochen Ähnliches gilt für die Studienwochen vom 6. bis zum 10. Juni. Hier können Interessierte eine Woche lang Projekte mit Forschern bearbeiten (http://www.soc.ethz.ch/orientation/studienwochen) und spannende Erfahrungen sammeln, die die spätere Studienwahl erleichtern.
ETH unterwegs
Die ETH Zürich gibt sich grosse Mühe, neue Studenten zu werben. ETH unterwegs ist eine Wanderausstellung von Lehrenden, die an Mittelschulen in der Schweiz Präsentationen abhalten, um Lust auf mehr Studium zu machen. Angesichts der steigenden Studentenzahlen offensichtlich mit Erfolg.
Beratungsangebote: wertvolle Hilfe rund ums Studium
Die kostenlose (und vertrauliche) Beratung durch die Studienberatung deckt viele Felder ab: Was tun bei Prüfungsmisserfolg? Sollte ich mein Studium wechseln und wie geht es dann weiter? Welche Studienwahl sollte ich treffen (Beratung vor Studienbeginn)? Auch Belange, die behinderte Studierende angehen, sind bei der Studienberatung an der richtigen Adresse. Sollte ein Student den Militärdienst während der Studienzeit absolvieren müssen, kann ein Studium in der Rekrutenschule diskutiert werden (Kontakt: http://www.soc.ethz.ch/people/advice).
Coaching: Hilfe für Anfänger
Vor allem am Studienbeginn stellen sich viele Fragen. Wie plane ich mein Studium? Wie ist mein Wissensstand im Allgemeinen? Kann ich mithalten? Wie kann ich mich am besten auf Prüfungen vorbereiten? Was tun, wenn Studien- oder sonstige Belastungen auftreten? Das Coaching hilft dem Studienanfänger, von Anfang an den Überblick zu behalten. Dabei sind mehrere Varianten möglich:
- Prestudy Events: die optimale Vorbereitung auf das Studium
- Peer Groups: Austausch unter Studierenden und Klärung neuer Fragen mit Tutoren
- Einzelcoaching: Unterstützung bei individuellen Anliegen
- Online-Anfrage: die ortsunabhängige Variante zum Einzelcoaching
Bislang dürfen Studenten von Bau, Umwelt und Geomatik, der Mathematik, Physik und von Maschinenbau und Verfahrenstechnik das Angebot in Anspruch nehmen. Ab 2012 soll es aber für alle Studierenden gelten. Nichtsdestotrotz handelt es sich um ein hilfreiches Rundumangebot, das nicht verpasst werden sollte. Effektiver kann niemand Anfängern ins Studium helfen und wenige Hochschulen bieten einen solchen Service an. Das Team des Coachings ist unter http://www.soc.ethz.ch/people/coaching zu finden, hier gibt es auch Kontaktadressen.
Bibliotheken – unentbehrliche Schätze
Die Bibliothek der ETH ist die grösste in der Schweiz und umfasst fast 30 Millionen Dokumente: Bücher, elektronische Medien, Zeitungen und andere Archivalien. Über das Online-Portal http://www.library.ethz.ch/de/Dienstleistungen kann gezielt nach Fachliteratur gesucht werden. Wichtig für Studienanfänger: Die Bibliothek bietet auch Führungen und Tutorials an, um den Einstieg in die Unmenge an Literatur zu vereinfachen und um zu zeigen, wie am besten recherchiert wird, wo die wichtigen Präsenzbestände sind und wo um Rat gefragt werden kann (http://www.library.ethz.ch/de/Dienstleistungen/Schulungen-Tutorials-Fueh...).
Diese Angebote sollten gleich zu Beginn genutzt werden, es gibt sie auch fachspezifisch. Zugriff auf die Datenbanken haben im Übrigen alle Angehörige der ETH Zürich. Gesondert angegliedert sind die Baubibliothek, die Bibliothek Erdwissenschaften, die GEss-Bibliothek (Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften) und die Grüne Bibliothek (Umwelt-, Agrar- und Lebensmittelwissenschaften). Auch hier gibt es professionelle Einführungen. In der ETH Zürich stehen ausserdem 90 Arbeitsplätze mit Internet-Zugang und unter anderem Kopierer und Drucker zur Verfügung. Rund 50.000 der gebundenen Bücher und Zeitschriften sind frei zugänglich und auszuleihen. Einen Ausweis beantragen, verlängern lassen, Gebührenbearbeitung, Auskunft, Beratung und Unterstützung bei der Recherche sind beim Info Center möglich.
Eine Liste der Ansprechpartner gibt es unter http://www.library.ethz.ch/de/Kontakt/Ansprechpartner.
Formales zur Bibliothek
Adresse: Rämistrasse 101, HG 30.1, Lageplan
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.00 bis 21.45, samstags von 9.00 bis 16.45
Kontakte: Information: Telefon +41 (0)44 632 21 35, E-Mail info@library.ethz.ch; Kundenservice, Telefon +41 (0)44 632 21 48, E-Mail service@library.ethz.ch, Leitung: Ursula Müller, Telefon +41 (0)44 632 09 19, E-Mail ursula.mueller@library.ethz.ch.
Die Fachbereichsbibliotheken sind unter http://www.ethz.ch/libraries/index mit Adressen und Kontaktdaten zu finden.
Das Vorlesungsverzeichnis und die Studienplanung
Das Vorlesungsverzeichnis der ETH Zürich ist jederzeit unter http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/sucheLerneinheitenPre.do?la... abrufbar. Wie in allen Fächern gilt: Sich rechtzeitig einen Überblick über die Erfordernisse des Studiums verschaffen, wirtschaftlich die zu belegenden Veranstaltungen verteilen, sich möglichst mit anderen Studierenden zusammenschliessen, um Austausch zu pflegen und sich frühzeitig für Module anmelden. Zwar ist die ETH Zürich nicht geradezu überlaufen, aber bestimmte Professoren und Module erfreuen sich doch grosser Beliebtheit und eine rechtzeitige Anmeldung kann nur von Vorteil sein. Anmeldung zu Prüfungsterminen, Studienwechsel und Studieneinschreibung sind unter http://www.rektorat.ethz.ch/calendar/students abrufbar.
Forschung: ein grosses Thema
Forschung ist ein grosses Thema an der ETH Zürich, überdurchschnittlich viele Immatrikulierte sind Doktoranden, immer wieder ist die Hochschule in den Medien aufgrund von überzeugenden Forschungsergebnisse vertreten. Vor allem für Studienanfänger, die Ambitionen in Richtung Forschung haben, ist die ETH daher richtig. Die Weichenstellung sollte dabei früh erfolgen. Einen wichtigen Überblick über Forschungsförderung gibt die Seite http://www.vpf.ethz.ch/researchfunding/index. Hier lohnt es sich, durchzuklicken und nach Projekten und Projektförderungen zu schauen. Auch sollte es nicht versäumt werden, frühzeitig Kontakte zu knüpfen: Bei Lehrenden nachfragen, sich umhören, welche Forschungsprojekte es derzeit gibt und wie die Teilnahmebedingungen aussehen, regelmässig das schwarze Brett studieren, im Gespräch bleiben. Um sich für einen solchen Einstieg zu qualifizieren, ist es natürlich das Beste, mit guten Leistungen aufzufallen – von Anfang an.
Militärakademie der ETH Zürich (MILAK)
Die Militärakademie, die der ETH angegliedert ist, dient der Aus- und Weiterbildung von Berufsoffizieren der Schweizer Armee. Sie ist fast ein Kuriosum innerhalb der ETH. Allerdings ist sie auch ein internationales Kompetenzzentrum für Militärwissenschaften. Die Militärakademie ist wissenschaftlicher Teil der ETH, aber auch Teil der Ausbildung für Höhere Kader der Armee. Sie beinhalten insgesamt drei Ausbildungsgänge und Weiterbildungen, um höhere Kader innerhalb der Armee zu erreichen. Je nach Ziel der Ausbildung sind unterschiedliche Voraussetzungen notwendig: Maturität, keine Maturität, akademische Vorbildung. Die Angliederung der Militärakademie an die ETH ist immer wieder umstritten, doch mag sie für Interessierte ebenfalls eine Option bieten. Kontaktadressen: E-Mails: personelles.J1@vtg.admin.ch, rekrutierung.J1@vtg.admin.ch, info@vtg.admin.ch.
Studentische Organisationen – Studierende helfen Studierenden
Zunächst sind hier die Fachvereine zu nennen, andernorts Fachschaften genannt. Sie sind die Vertreter der Studierenden gegenüber Fach/Institut. Insbesondere bei einer missglückten Prüfung können die Angehörigen der Fachvereine helfen, die in der Regel auch sonst sehr hilfreich sind bei Tipps rund ums Studium. Daneben bietet sich hier insbesondere der persönliche Kontakt an, der in vielerlei Hinsicht fruchtbar sein kann.
Der Verband der Studierenden an der ETH – VSETH
Die Studentenvertretung gegenüber Hochschulleitung und Öffentlichkeit hat auf ihrer Website eine Menge nützliche Tipps rund ums Studium zusammengestellt: http://www.vseth.ethz.ch/index.php?section=home. Unter anderem sind hier die Kontaktadressen zu den Fachvereinen gelistet. Der VSETH ist in zahlreichen Gremien der Hochschule vertreten, wo er die Interessen der Studentenschaft vertritt. Auch VSETH als übergeordnetes studentisches Organ ist oft hilfreich bei Fragen und Problemen. Leichter gemeinsam lernen lässt es sich im Übrigen gut mit Hilfe von günstigen Telefonkonferenzen.
Positives Fazit – an der ETH Zürich gut aufgehoben
An der ETH Zürich wird eine Menge verlangt, aber es bieten sich auch beste Aussichten. Beratungsorgane der Hochschule sowie der studentischen Organisationen helfen in der Regel mit Rat und Tat. Wichtig ist es, die Einführungsangebote (Bibliothek, Hochschule, Studentenverbände) anzunehmen, da sie optimale Einstiegsmöglichkeiten bieten. Organisation und Planung des Studiums bilden aber die wichtigsten Bausteine. Sollte es einmal nicht mehr vorwärts gehen, lohnt es sich auch das Gespräch mit einem Kommilitonen zu suchen, mit dem freundschaftliche Bande geknüpft wurden, der möglicherweise ebenfalls entscheidende Tipps geben kann. Die soziale Komponente im Studium ist nicht zu unterschätzen. Information, Planung, Organisation, soziales Miteinander sind die Schlüsselbedingungen jeden erfolgreichen Studiums. An der ETH Zürich sind hierbei die besten Voraussetzungen gegeben. Noch vor Studienbeginn die Einführungsangebote aller Offerenten nutzen, sich ein Bild und einen Plan machen – einem erfolgreichen Studienabschluss und möglicherweise einer wissenschaftlichen Karriere steht dann nichts mehr im Wege.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität Zürich: Tipps & Tricks
 |

Die Universität Zürich: Die größte Schweizer Universität mit dem grössten Angebot
Mit knapp 26'000 Studierenden ist die Universität Zürich die größte Universität der Schweiz. Doch sie steht auch für höchsten wissenschaftlichen Standard, denn zahlreiche Nobelpreisträger sind hier hervorgegangen. Sieben Fakultäten bieten heute eine breitgefächerte Auswahl an Studienfächern, die allesamt der Bologna-Reform verpflichtet sind, das heisst, es handelt sich um Bachelor- und Masterstudiengänge. Doch obwohl die Universität zunächst gross wirkt, dürfen auch Studienanfänger unbesorgt sein: Ein breites Beratungsnetz, Anlaufstellen für Fragen rund ums Studium oder bei sonstigen Problemen sowie eine Vielzahl von studentischen Organisationen sind da, um bei der Orientierung zu helfen. Ebenso wie ihr wissenschaftliches Niveau hat die Universität Zürich auch stetig ihr Organisationsnetz ausgebaut. Anbei sind die wichtigsten Tipps, Anlauf- und Beratungsstellen und Studienratschläge gelistet, um vom ersten Studientag bis zur Abschlussprüfung ein erfolgreiches Studium zu absolvieren.
Von: Marijana Babic
Immatrikulation: Wo und wie?
Alle Fristen für die Immatrikulation finden sich unter www.uzh.ch/studies/application/generalinformation/deadlines.html. Achtung: Obwohl verspätete Immatrikulationen möglich sind, werden dann saftige 250.- CHF als Gebühr erhoben (statt 50.- CHF). Studienbewerber mit Schweizer oder ausländischem Bildungsabschluss haben unterschiedliche Bewerbungsfristen. Die Bewerbung kann online erfolgen, bei Genehmigung erhalten Studienanfänger ihr UniAccess-Konto mit E-Mailbox. Kontaktadresse ist die Kanzlei der Universität Zürich montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr, Telefon +41 (0)44 634 22 17 (E-Mail kanzlei@uzh.ch). Ausländische Bewerber Für ausländische Bewerber ist die Zulassungsstelle (Telefon +41 (0)44 634 22 36, E-Mail admission@uzh.ch) zuständig. Erforderlich ist die Schweizer Maturität oder ein von der Schweiz als gleichwertig anerkannter Abschluss. Dies ist mit der jeweiligen Stelle zu klären. Reichen die Voraussetzung nicht aus, wird eine Prüfung auf Maturitätsniveau anberaumt. Über Modalitäten und die Abwicklung informiert die Universität Zürich, Abteilung Studierende, Aufnahmeprüfung, Telefon +41 (0)44 634 45 11/13 (E-Mail: aufnahmepruefung@ad.uzh.ch).
Heisser Tipp: Teilnahme an den Informationstagen
Allen Anfängern seien die Studieninformationstage ans Herz gelegt, die regelmässig stattfinden. Fakultäten, Seminare und Institute stellen sich hierbei vor, Teilnahme an klassischen Vorlesungen, vertiefende Studienpräsentationen und Besuche von Laboren, Museen, etc. runden das Angebot ab. Die aktuellen Termine sind immer unter www.studieninformationstage.uzh.ch/schedule.html zu finden. Die Anmeldung kann erfolgen unter Telefon +41 (0)44 632 27 71 oder per E-Mail susanne.darcy@soc.ethz.ch. Bei den Informationstagen kann schon eine Menge Wissenswertes über das Studium in Erfahrung gebracht und erste Kontakte geknüpft werden.
Gut informiert - guter Einstieg: Beratungsangebote
Neben den Studienanfängereinführungen, die für das nächste Sommermester aktuell unter www.studienberatung.uzh.ch gefunden werden können, ist an erster Stelle die fakultäts- und fachübergreifende Studienberatung, die eine Verbindungsnaht zwischen den Beratungen der Institute und Fakultäten bildet, zu nennen. Hilfe finden Studierende hier in Fragen der Studienwahl oder gegebenenfalls des Wechsel und bei der Planung und Organisation des Studiums. Thema sind auch Lernvorbereitungsmethoden bzw. die Herangehensweise an Prüfungen. Nicht zuletzt hilft die übergreifende Beratung dabei, in den jeweiligen Fakultäten und Instituten den richtigen Ansprechpartner zu finden. Eine gute Adresse also, vor allem wenn sich der Studienanfänger zunächst erschlagen fühlt von dem Überangebot. Kontaktmöglichkeiten gibt es unter Telefon +41 (0)44 634 21 44 oder per E-Mail: studienberatung@ad.uzh.ch. Unter der Rubrik ‚Studium‘ (www.degrees.uzh.ch) hat die Universität ausserdem alle wichtigen Informationen zu allen Studiengängen (wie Voraussetzungen und Inhalte) bereitgestellt. Beim Durchklicken bis zum jeweiligen Studiengang gelangt der User auch zur Kontaktadresse der jeweiligen Beraterin oder des Beraters, an die sich Fragende wenden können. Grundsätzlich gilt: Für Bachelor-Studiengänge müssen 180 Creditpoints erworben werden (durch Besuch von Veranstaltungen und Anfertigung von Referaten und/oder Hausarbeiten). Ziel sind sechs Semester Studienzeit. Ein Masterstudiengang wird mit 120 Creditpoints absolviert. Weitere Beratungsstellen, die sich um Themen rund um das Studium kümmern (z.B. Finanzierung oder psychologische Probleme), sind unter www.uzh.ch/studies/infoadvice/advice.html zu finden. Gleichgültig, welche Beratungsstellen nun aufgesucht werden, ist es unabdingbar zu klären, was im jeweiligen Studiengang erwartet wird und wie die Belegung der Module - die Voraussetzung für einen Abschluss sind - am besten ökonomisch über die Studienzeit verteilt werden. Anhand dessen kann mithilfe des Vorlesungsverzeichnisses, das jeweils so früh wie möglich erworben werden sollte, abgestimmt werden, was wie wann belegt wird (www.vorlesungen.uzh.ch/HS10/lehrangebot.html). Die Vorlesungsverzeichnisse der Universität sind sehr detailliert und geben zum Beispiel an, mit welchen Leistungen Creditpoints erworben werden können. Der Studienanfänger sollte sich bewusst sein, dass Zürich eine hervorragende, aber auch sehr grosse Universität ist und Leistungsmodule, mit denen die Kreditpunkte nach dem System von Bologna erworben werden müssen, häufig überlaufen sind. In diesem Fall gilt das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Modulbuchungen sind online möglich unter www.students.uzh.ch/booking.html. Jede/r sollte sich bewusst sein, dass Planung und Organisation im Studium mehr als die halbe Miete sind – und zwar von Anfang an.
Bibliotheken – wo finde ich was?
Kein Referat, keine Hausarbeit, keine Abschlussprüfung ohne Bibliotheken: Sie sind die Zentralen allen Wissens. Umso besser, wenn Studienanfänger frühzeitig lernen, damit umzugehen und wissen, wo sie was finden. Als grösste Schweizer Universität ist Zürich auch in Sachen Literatur bestens ausgerüstet. Die Hauptbibliothek der Uni Zürich ist naturwissenschaftlich/technisch und medizinisch orientiert (http://www.hbz.uzh.ch/). Doch auch die Institute sind hier vertreten. Eine Linkliste gibt es unter http://www.hbz.uzh.ch/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=75&limitstart=50〈=de. Die Berechtigung für die Hauptbibliothek erhält jeder Nutzer mit der Immatrikulation. Die Datenbanken der Institute sind in der IDS Recherche katalogisiert. Die Zentralbibliothek Zürich mit rund fünf Millionen Dokumenten wiederum ist für alle da: für die Öffentlichkeit und für Studierende aller Fachrichtungen. Unter www.zb.uzh.ch kann auch online nach Beständen recherchiert werden. Die Zentralbibliothek, die sich in Zürich am Zähringerplatz 6, befindet, ist nach Fachrichtungen sortiert, beinhaltet aber auch kantonale Sammlungen. Ein Ausweis ist nach Vorlage des Personalausweises in der Bibliothek erhältlich, die Ausleihfrist für ausleihbare Exemplare beträgt vier Wochen. Darüber hinaus ist es möglich, sich Kopien anfertigen zu lassen (gegen Entgelt) oder per Fernleihe aus anderen Bibliotheken zu bestellen. Auskunft und Informationsstellen stehen für Fragende zur Verfügung, beispielsweise falls etwas nicht gefunden werden kann. Für Studenten, die sich erstmals anmelden, ist die Ausfüllung eines Online-Formulars notwendig (http://opac.nebis.ch/F?local_base=zbz&con_lng=GER&func=file&file_name=bor-new). Sie erhalten dann ebenfalls nach Vorlage ihres Ausweises eine Berechtigungskarte. Auch ein wichtiges Angebot, um sich gleich anfangs in dem Wust an Fachliteratur zurechtzufinden: Die Bibliothek bietet kostenlose Führungen und Einweisungen in die Literaturrecherche an. Dies sollten Studienanfänger berücksichtigen. Derzeit werden die Führungen für Studienanfänger immer montags und dienstags um 18 Uhr angeboten. Tipp: Viele Dokumente, alles digital und Unordnung auf dem Computer? Software zum Dokumentenmanagement hilft, den Überblick zu behalten.
Austauschprogramme: In fremde Welten reinschnuppern
Bewerber um Jobs haben grundsätzlich bessere Karten, wenn sie Auslandsaufenthalte vorweisen können. Neben den persönlichen bereichernden Erfahrungen wie verbesserte Sprache und Weitung des Horizontes sind solche Absolventen auch deswegen beliebt, weil sie flexibler und umfassender auf Problemlösungen reagieren können. Ein Auslandsaufenthalt gehört zu einem Studium also unbedingt dazu. Im Rahmen von ERASMUS bietet die Universität Zürich Austauschprogramme mit insgesamt 200 europäischen Hochschulen an. Bilaterale Abkommen der Uni eröffnen weitere Möglichkeiten: Unter www.int.uzh.ch/static/single/austausch/index.php?r=out&l=de findet sich eine Liste der Partneruniversitäten. Das Programm ISEP bietet ausserdem die Möglichkeit, an einer von 140 Universitäten in den USA und weiteren 60 Hochschulen weltweit ein Auslandsstudium zu absolvieren.
Abgesehen davon haben die Fakultäten zusätzlich Fachabkommen geschlossen (mehr Informationen unter www.int.uzh.ch/out/austausch/facultyagreements.html).
Die gleichen Angebote gelten für ausländische Studierenden, die ein oder zwei Semester in Zürich verbringen wollen. Für ausländische Studierende hat die Universität ausserdem eine Liste „Wissenswertes“ angefertigt, die alle Bereiche des Lebens in Zürich abdeckt (www.int.uzh.ch/in/wissenswertes.html). Studenten, die Quellen, Verträge oder Hausarbeiten übersetzt haben wollen, denen wird u.a. die günstige Übersetzungsagentur Typetime nahegelegt.
Studentische Organisationen: Gleiche setzen sich für Gleiche ein
Die Vertretung der Studierenden gegenüber Öffentlichkeit und Universitätsleitung (in Zürich StuRa genannt), die in verschiedenen Gremien vertreten ist, die Fachschaften und die studentischen Verbindungen sind wichtige Anlaufstellen sowohl für Studienanfänger als auch für Fortgeschrittene. Studenten verstehen am besten, wo die Nöte anderer Studenten liegen.
Sie können zunächst mit hilfreichen Tipps helfen: Welcher Dozent ist wie? Vor wem sollte man sich in Acht nehmen? Wo gibt es in der Stadt die billigsten Lebensmittel? Welche Rechte hat ein Student, wenn beispielsweise eine Hausarbeit miserabel beurteilt wurde? Wie schreibe ich überhaupt eine richtige Hausarbeit? Was tun, wenn der Professor sich nicht korrekt verhält?
Fachschaften
Konkret die Fachschaften kennen sich – wie der Name schon sagt – am besten mit dem jeweiligen Fach aus. Erstsemestern unter die Arme greifen, indem beispielsweise eine besonders gut gelungene Hausarbeit als Anschauungsmaterial ausgeliehen wird, sie sozial einbinden und zu einführenden Aktivitäten einladen, Tipps für die Benutzung von Bibliotheken und Fachliteratur geben: Das können Mitglieder der Fachschaft am besten. Sie vertreten ausserdem ganz konkret die Interessen der Studenten gegenüber dem Institut.
StuRa
Der StuRa ist sozusagen das übergeordnete Organ. Doch auch die Mitglieder der StuRa sind in der Regel bereit, Anfängern zu helfen. Die StuRa organisiert auch Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Sie sind das Sprachrohr gegenüber Öffentlichkeit und Universitätsleitung.
Studentische Verbindungen
Studentische Verbindungen sind Organisationen, in denen sich Studenten unter einem besonderen Themenschwerpunkt zusammengefunden haben (z.B. Turner, Sänger, Patrioten, etc.). Sie können Studenten eine Art Heimat und sozialen Zusammenhalt bieten. Was infrage kommt, das hängt vom einzelnen und dessen Anschauungen ab. Näheres gibt es unter www.uzh.ch/studies/studentlife/organizations/associations.html.
Diverse Organisationen
Daneben gibt es noch eine Reihe unterschiedlichster Organisationen, die ganz verschiedene Interessen vertreten: www.uzh.ch/studies/studentlife/organizations/various.html. Wenn beispielsweise ein türkischer Student Seinesgleichen sucht, wird er hier fündig.
Vernetzung mit anderen Studierenden ist auf alle Fälle wichtig, welcher Art diese auch sein mag. Wer Kontakte hat, ist auf dem Laufenden, kann sich informieren und fühlt sich im Massenbetrieb einer grossen Universität nicht alleine, was nicht zuletzt auf den Studienerfolg Auswirkungen hat.
Lokalitäten: Wo ist was?
Leider befindet sich die Universität Zürich nicht in einem Komplex. Für die jeweiligen Institute und Standorte muss der Sucher sich daher jeweils einzeln einen Lageplan anschauen. Im Internet sind aber alle Institute gelistet (Suchwort Google: Lageplan Universität Zürich).
Vor allem für Erstsemester gilt daher, sich rechtzeitig die Lokalität herauszusuchen, vielleicht vor Beginn des Studiums alle relevanten Orte ablaufen, Verbindungslinien ausfindig zu machen, etc. Häufig sind diese auf den Lageplänen der Institutsseiten gelistet.
Einen groben Überblick gibt es auch unter www.plaene.uzh.ch/lageplaene/index.html#ankermap.
Forschung: Die Universität als Labor
Die Universität Zürich ist international für ihre Forschungsarbeiten anerkannt. Sogar Nobelpreisträger hatten/haben hier ihr Zuhause. Für Menschen, die sich vor, während oder nach ihrem Studium für Forschung in ihrem Fach interessieren, ist dies ein wichtiger Link mit der Listung von Förderprogrammen, etc.: www.researchers.uzh.ch/index.html. Wichtig ist es, möglichst früh in die Forschung reinzuschnuppern, wenn diesbezüglich Ambitionen bestehen, damit auch die notwendigen Kontakte geknüpft und Kenntnisse erworben werden können. Die Teilnahme an einem Forschungsprogramm kann auch in einer Masterarbeit münden, hier ist es ebenfalls sinnvoll, schon früh einen „Fuss in der Tür“ zu haben.
Im falschen Studium gelandet?
Manchmal kann ein Studienfanfänger auch einen Fehler bei der Wahl der Fächer machen. Vielleicht hat er oder sie sich auch etwas anderes darunter vorgestellt. Die Frage ist nur: Handelt es sich um eine vorübergehende Ermüdungsphase oder ist tatsächlich ein Studienwechsel sinnvoll? Erörtert werden können diese Fragen bei der Studienberatung (Kontaktmöglichkeiten: Tel. +41 (0)44 634 21 44, E-Mail: studienberatung@ad.uzh.ch). Sollte tatsächlich ein Fächerwechsel sinnvoll sein, sollte dieser möglichst schnell angepackt werden. Denn wozu kostbare Zeit verplempern? Häufig können erworbene Creditpoints im neuen Fach angerechnet werden. Es besteht also kein Grund, die Hoffnung aufzugeben, wenn es beim ersten Anlauf nicht geklappt hat.
Das Wichtigste auf einen Blick
Die Website von größter Bedeutung für Studierende ist und bleibt die Website der Universität: www.uzh.ch/index.html. Hier sind alle wichtigen Informationen und Kontaktadressen gelistet.
Organisation und Planung:
Sich von Anfang an kompetent beraten lassen, sich einen Überblick verschaffen und die Leistungen ökonomisch übers Studium verteilen: Dies ist der wichtigste Impuls für ein erfolgreiches Studium.
Soziale Kontakte mit fachlicher Kompetenz:
Auf keinen Fall sollte das Beziehungsnetzwerk, das aus Fachschaften und studentischen Verbindungen bestehen kann, vernachlässigt werden. Es verleiht intellektuelle und soziale Stabilität und Rückhalt.
Bibliotheken:
Mit dem System der Bibliotheken sollte sich jeder Student alsbald vertraut machen, vielleicht schon vor Studienbeginn. Die Organisation der richtigen Fachliteratur macht einen wesentlichen Teil des Studiums aus.
Auslandserfahrungen:
Die Universität Zürich bietet eine Menge Möglichkeiten. Diese sollten auch genutzt werden, um über den eigenen Tellerrand hinausschauen zu können und um bei späteren Arbeitgebern zu punkten.
Sollten seminarbegleitende Angebote wie Tutorien und Übungen angeboten werden, sollten diese Möglichkeiten unbedingt ausgeschöpft werden. Hier können Fragen gestellt werden, die sich im Seminar selbst möglicherweise niemand erlaubt, wissenschaftliches Arbeiten geübt werden und allgemeine Tipps erhalten werden. Denn meist werden die Tutorien von älteren Semestern abgehalten, die sich gut in Studienanfänger hineinversetzen können. Der Teilnehmerkreis ist außerdem häufig klein, was ebenfalls Möglichkeiten birgt. Die Tutorien sind die beste Option, um teilnehmerangepasst Fragen zu erörtern.
Berücksichtigt der Studienanfänger alle Tipps, kann eigentlich nichts mehr schief gehen!
Weitere Tipps:
Zusammen lernen macht mehr Spass und ist effektiv. Manchmal ist eine Treffen jedoch schwierig zu organisieren. Unkomplizierte Telefonkonferenzen können da schnell Abhilfe schaffe. Und wenn es noch realitätsnäher sein soll, dann informieren Sie sich über die vielen Möglichkeiten der Videokonferenz.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren an der Universität Bern: Tipps & Tricks
 |

Die Universität Bern: Allgemeines
Neu im Studium und viele Fragen sind offen? Keine Bange, denn die Universität Bern bildet mit nahezu 15.000 Studierenden einen zwar großen, aber immer noch recht übersichtlichen Rahmen, in dem viele Informationsmöglichkeiten gegeben sind. Die Uni Bern ist dabei eine sogenannte Volluniversität mit acht Fakultäten und rund 160 Instituten und ist den Reformen von Bologna verpflichtet: das heißt, es handelt sich weitgehend um Bachelor-Studiengänge, an die ein Master-Studium angeschlossen werden kann. Studienleistungen werden daher in Form von ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System - kurz: in Form von Kreditpunkten bewertet. 180 Punkte sind hierbei für einen Bachelor-Abschluss erforderlich, 90 bis 120 Kreditpunkte werden für ein Master-Studium benötigt. Im Folgenden gibt es Tipps und Ratschläge, um an der Uni Bern erfolgreich durch das Studium zu kommen. Planen und Informieren: Das sind dabei die wichtigsten Schlüsselwörter für einen Studienerfolg. Von der Erstellung eines Studiumplans über die Benutzung der Bibliothek bis zu hin der Frage, wo an der Uni Bern wertvolle Informationen erhältlich sind, darum geht es nun. Denn ein gutes Informationsnetz ist auch ein gutes Sicherheitsnetz.
Von: Marijana Babic
Vorab - Informationstag für Studieninteressierte
Allen Neustudierenden an der Universität Bern sei der Informationstag ans Herz gelegt: Es handelt sich hierbei um einen Informations- und Orientierungstag mit Gelegenheit, sich über die 40 Bachelor-Studiengänge zu informieren. Dozenten und Studierende sowie die wichtigsten Organe der Universität stellen sich vor. Selbstverständlich können auch Fragen gestellt und Kontakte geknüpft werden. Die Termine dieses Jahr sind einsehbar auf http://www.infotage.unibe.ch .
Studienplanung - Wie organisiere ich mein Studium?
Was wird in meinen Fächern von mir erwartet? Welchen Inhalten und Anforderungen sollte ich an der Uni Bern genügen? Wie kann ich entsprechend mein Studium am besten organisieren? Für diese Fragen ist die Studienfachberatung des jeweiligen Instituts die hilfreichste Adresse. Insbesondere, da es an der Uni Bern vorkommen kann, dass sich Veranstaltungen überschneiden oder zum Beispiel wegen Überbelegung nicht besucht werden können, ist eine Studienplanung wichtig. Die Studienfachberatung hilft dabei, von Anfang an den Überblick zu bewahren und bei der Klärung der Frage, wie die Kreditpunkte am besten erworben werden können. Das Niveau an der Uni Bern ist dabei durchgehend relativ hoch. Dieser Anforderung sollten sich Studierende stets bewusst sein. Daher sollte man von Anfang an am Ball bleiben.
Stundenpläne
In einigen Fächern sind die Stundenpläne fest, in anderen müssen sie erst mühsam zusammengestellt werden. Hierbei sollte im Vorfeld eine Auswahl aus allen in Frage kommenden Veranstaltungen getroffen werden, um dann Major- und Minorfächer abzustimmen. Priorität sollten bei Überschneidungen stets Majorfächer (Hauptfächer) haben. Unabdingbar ist es deswegen, sich stets rechtzeitig das Vorlesungsverzeichnis anzuschauen, um sich so gegebenenfalls früh für eine Veranstaltung anmelden zu können. Das Vorlesungsverzeichnis gibt es in gedruckter Form oder im Internet unter www.evub.unibe.ch/pievub Ferner ist gleich zu Beginn zu vergegenwärtigen, welche Pflichtveranstaltungen überhaupt absolviert werden müssen. Diese sollten über die Semester im Grundstudium ökonomisch aufgeteilt werden. Gleiches gilt für das Hauptstudium. Wenn Interessen und Pflicht möglichst nahe beieinander liegen, umso besser. Da die Uni Bern viele Auswahlmöglichkeiten bietet, sollte hier für jeden etwas zu finden sein.
Studiengliederung
Die Universität Bern ist den Bologna-Reformen verpflichtet, deswegen gibt es keine großen Prüfungsblöcke am Ende des Studiums. Leistungen sollen vielmehr kontinuierlich erbracht werden. Als Veranstaltungsformen werden in Bern Proseminare (Grundstudium), Seminare, Vorlesungen, Übungen und Tutorien praktiziert. Die Tutorien sind wertvoll, sie sind einem Proseminar oder Seminar angegliedert und werden von älteren Studierenden geleitet. Meist ist die Teilnahme freiwillig, es empfiehlt sich aber, an den Tutorien teilzunehmen. Dort wird nämlich zum Beispiel auch wissenschaftliches Arbeiten wie 'Richtiges Zitieren' geübt, außerdem können sich die älteren Semester häufiger besser in Anfänger hineinversetzen und sind oft wichtige Anlaufstellen. Dort können auch Fragen abgeklärt werden, die in der eigentlichen Veranstaltung offen geblieben sind.
Örtlichkeiten und Prüfungsanmeldung
Wo finde ich was? Alle wichtigen Räumlichkeiten wie Bibliotheken, Computerzugang und Stadtpläne gibt es unter www.bau.unibe.ch/raeume/rauminfo.htm. Die Anmeldungen zu Prüfungen ist an der Universität Bern online über das System "ePUB" möglich: www.epub.unibe.ch/epub. Die meisten Bachelor-Kurse werden nur als Kreditpunkte angerechnet, wenn am Semesterende noch an einer abschließenden Klausur teilgenommen wird. Es ist aber auch möglich, dass eine Präsentation gehalten werden muss. Obwohl viele vor Referaten zurückschrecken, sollten gerade diese geübt werden. Dies ist zum Beispiel in den Tutorien möglich. Prüfungen können entweder am Semesterende oder am Anfang des nächsten Semesters abgelegt werden. Materialien zu den Vorlesungen befinden sich (passwortgeschützt) im Internet oder werden - in der Regel teuer - zu Beginn der Vorlesung verkauft.
Wie sieht der Studienalltag aus?
Aufgrund der Vielzahl an Gebäuden, die sich zwar konzentrieren, aber dennoch gefunden werden müssen, sollte zeitig ein Überblick da sein, wo die Vorlesungen stattfinden (Aufpassen während der Orientierungswoche lohnt sich). Die Vorlesungen wiederum sind in zwei 45-Minuten-Blöcke aufgeteilt mit einer 15-minütigen Pause dazwischen. Die Klassen sind überschaubar, da die Universität nicht so exorbitant groß ist. Dies ermöglicht besseren Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden und zwischen den Studierenden untereinander. Dieser Vorteil sollte genutzt werden. Zwischen den einzelnen Veranstaltungen gibt es oft Pausen. Dies sollte bei der Stundenplan-Erstellung berücksichtigt werden. Wer die Zeit nicht in der Cafeteria verbringen, sondern für sein Studium nutzen will, kann dies dank Wireless LAN: Laptops funktionieren auch drahtlos. Dies ist hilfreich, wenn die Computerräume wieder einmal überfüllt sind.
Studentische Verbindungen
Wertvolle Unterstützung können auch die jeweiligen Fachschaften bieten, die die Studierendeninteressen auf unterster Ebene vertreten. Die Kontaktadressen sind unter www.unibe.ch/campus/grup_fach.html für alle Fächer zu finden. Es empfiehlt sich, früh Kontakte zur Fachschaft zu knüpfen, um auch persönliche Stabilität in dem doch recht umfangreichen Studium zu gewährleisten.
Weitere Kontaktadressen
Auch ansonsten lohnt es sich, Ausschau nach einer passenden Gruppe zu suchen, die unterstützen kann. Die Fachschaften der Uni Bern sowie weitere studentische Verbindungen gibt es unter www.unibe.ch/campus/gruppen.html.
Die StudentInnenschaft SUB
Bei Kummer im Studium steht auch die allgemeine Studenvertretung, die StudentInnenschaft der Universität Bern (SUB), zur Verfügung. Unter der E-Mail-Adresse kummerkasten@sub.unibe.ch können Anliegen vorgebracht, Fragen gestellt und Kontakte geknüpft werden. Außerdem stehen Freiwillige als Mittlerstudenten bereit, an die sich Fragende wenden können: der sogenannte Studipool. Eine Liste der Mittlerstudenten in den einzelnen Fächern gibt es unter www.sub.unibe.ch/dienstleistungen/studentinnenpool/liste_studipool/index_ger.html. Der SUB bietet außerdem Rechtshilfe-Erstberatung und Stipendienberatungen an. Weitere Infos gibt es unter: https://subnew.unibe.ch/web/
Universitätsbibliothek - die Wissenszentrale
Jedes Studium steht und fällt damit, ob frühzeitig gelernt wird, Literatur zu beschaffen und mit dieser fachgerecht umzugehen. Die Universitätsbibliothek ist dabei eine zentrale Stelle. Die Zentralbibliothek mit 49 zugeordneten Bibliotheken umfasst aktuell rund 4,2 Millionen Bände. Neben dem Freihandbestand gibt es auch Präsenzobjekte wie Zeitschriften oder historische Bestände, die nur in der Bibliothek selbst gelesen werden können. Viele der Medien sind nur eingeschränkt oder nicht ausleihbar. Es lohnt sich also, stets eine Copycard griffbereit zu halten. Studenten der Universität Bern erhalten automatisch eine Nutzerberechtigung für die Bibliothek. Tipp: Zu Semesterbeginn werden jeweils Führungen abgehalten, bei denen auch das Bibliothekssystem erklärt wird. Es lohnt sich, daran teilzunehmen. Da die Bibliotheken von unschätzbarer Wichtigkeit sind, sollten sich Studierende recht bald damit vertraut machen. Im Zweifelsfall: Die Auskunft fragen! Für Fragen steht von 10 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag die Auskunft zur Verfügung. Hierbei gibt es auch spezielle Fachreferenten. Fragen können auch per E-Mail an die Auskunft gerichtet werden, die Adressen gibt es unter www.ub.unibe.ch/content/e426/e485/e3801/index_ger.html. Fernleihe Es ist auch möglich, Medien per Fernleihe zu bestellen oder sich Zeitschriftenartikel in Kopie geben zu lassen (Kopierzentrale, gegen Kosten). Online recherchieren Es ist außerdem im Angebot, online Bestände zu recherchieren. Alle verfügbaren Bibliotheken sind unter folgendem Link zu finden: www.unibe.ch/bibliotheken/online_recherche.html.
Praktika, Ferienjobs, etc.
Neben allem studentischen Eifer ist es notwendig, via Praktika oder Ferienjobs am Puls der Zeit zu bleiben. Vor allem wer schon konkrete Berufsvorstellung hat, dem können solche praktischen Erfahrungen später in den Job helfen; anderen mögen sie zur Orientierung dienen. Außerdem bilden Praktika einen guten "Blick über den Tellerrand", da Universitäten Binnenwelten für sich sind. Jobs in Bern gibt es zum Beispiel unter bei der SUB unter https://subnew.unibe.ch/web/guest oder alternativ beim privaten Anbieter www.studijob-bern.ch .
Das Studium muss möglicherweise selbst finanziert werden? Es gibt Probleme mit den Finanzen? In der Schweiz hängt ein möglicher Studienabschluss immer noch sehr davon ab, wie finanzstark die eigene Familie ist und aus welchem Kanton der Student oder die Studentin stammt, zumal ein Studium gebührenpflichtig ist. Der SUB bietet deswegen eine umfassende Stipendienberatung an, damit Studienerfolg nicht von den Finanzen abhängt und es im schlimmsten Fall nicht zur Kontopfändung kommt.
Weiterbildung
Sprachen sind sowohl für das Unileben wie auch für den späteren Beruf unverzichtbar. Sprachkurse sind daher eines der wichtigsten Angebote zur Weiterbildung an der Uni Bern. Angeboten werden bei Abteilung für angewandte Linguistik unter anderem auch Exoten wie Arabisch, Chinesisch und Russisch, die als Zusatzqualifikation besonders nützlich werden können, da sie selten sind. Da die Teilnehmerzahl meist auf 20 beschränkt ist, ist eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Genaueres gibt es unter http://www.aal.unibe.ch/content/index_ger.html. Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studierende und Englisch als Wissenschaftssprache wird beim Zentrum für Sprachkompetenz angeboten (http://www.zsk.unibe.ch/content/index_ger.html). Eine Idee ist auch das Tandem-Lernen: Angehörige verschiedener Muttersprachen unterstützen sich gegenseitig beim Lernen. Einen guten Übersetzungsdienst mit qualifizierten Übersetzern finden Sie hier.
Ausländische Studierende
Der Kanton Bern liegt zwar im deutschsprachigen Teil der Schweiz, gehört aber dennoch zu einer anderen Kultur. Dies mag ein Studium an der Uni Bern auch für Deutsche oder Österreicher zu einer sinnvollen Erfahrung machen. Für ein Studium an einer Schweizer Universität wird die Maturität gefordert.
Die genauen Zulassungsbedingungen finden sich auf der Interseite http://www.zib.unibe.ch . Detailiert gibt die Broschüre "Zulassungsbedingungen 12/13" Auskunft.
Auslandssemester
Ein Auslandssemester sollte zu jedem Studium dazugehören, denn dies sind beliebte Referenzen bei zukünftigen Arbeitgebern. Die richtige Anlaufstelle dafür ist an der Universität Bern das Internationale Büro (Tel +41 (0)31 631 41 75). Möglich sind Auslandsstudien an 150 Universitäten der USA sowie 80 weiteren Universitäten weltweit. Außerdem unterhält die Uni Bern Kooperationen mit 240 Universitäten in Europa im Zuge des ERASMUS-Programms. Dazu muss das Erasmus-Formular ausgefüllt werden. Dieses kommt innerhalb einer Woche zurück und muss dann bis zum 1. März resp. bis zum 1. Februar für die kommenden Semester beim jeweiligen Fachkoordinator abgegeben werden.
Förderung für sehr gute ausländische Studierende
Für 2011/12 verleiht die Uni Bern sechs Master Grants für Studierende aus dem Ausland, die sich durch besondere Leistung und Motivation hervortun. Die Stipendiaten erhalten monatlich 1.600 Franken pro Monat. Eine Kommission wählt die Stipendiaten aus. Voraussetzung ist neben sehr guten Leistungen, dass der Wohnort bislang ausserhalb der Schweiz lag.
Lust statt Frust: Studienfachwechsel
Nach zwei Semestern unglücklich und frustriert im Studienfach? Zunächst ist dem nachzugehen, ob es sich nur um ein momentanes Tief handelt oder ob tatsächlich eine falsche Studienwahl vorliegt. Solche Fragen können in der Beratung der Berner Hochschulen (Studienberatung) erörtert werden. Falls es sich aber tatsächlich um das falsche Fach handeln sollte, die realen Erwartungen sich nicht erfüllt haben, sollte spätestens nach zwei Semestern gewechselt werden - um nicht mehr Zeit zu verlieren. Die bisherigen Erfahrungen können genutzt werden. Häufig können dabei Scheine im neuen Studienfach angerechnet werden, auch ein Studienwechsel ist deswegen kein Beinbruch. Für den Studienwechsel müssen jedoch Fristen eingehalten werden. Diese sowie das Formular "Anmeldung Fachwechsel an der Universität Bern" gibt es auf http://www.zib.unibe.ch/content/daten/fachwechsel/index_ger.html.
Anlaufstellen
Alle wichtigen Anlaufstellen sind auch auf der Website der Universität Bern www.unibe.ch gelistet, eine der wichtigsten Web-Adressen für das ganze Studium. Die Universität hat ein gutes Informationsnetz für alle studentischen Belange geschaffen. Aber natürlich macht auch dieses ausführliche Gespräche mit Kommilitonen als Gleiche unter Gleichen nicht überflüssig. Manchmal lohnt es sich, auch einfach an den Anschlägen vorbei zu gehen, um gute Impulse aufzufangen.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Zitieren richtig gemacht

Um eine einwandfreie wissenschaftliche Arbeit zu produzieren, musst du nicht zuletzt auch richtig zitieren. Doch wie zitiert man richtig? Gibt es überhaupt so etwas wie "richtig zitieren" oder kommt es nicht einfach drauf an, einheitlich zu zitieren?
Von: S4S-Team
In der Tat akzeptieren es manche Professoren, wenn man sich nicht an definierte Zitiermethoden hält, solange man konsequent seine eigene Methode durchzieht. Es gibt jedoch auch Professoren, die eines der international anerkannten Zitiermethoden verlangen, so wie es akademische Journals auch tun.
Die im englischsprachigen Raum am häufigsten genutzte Zitierweise ist die sogenannte "Harvard-Methode". Sie wird auch immer häufiger von deutschen Wissenschaftlern und Studenten angewandt. Es ist also egal, ob du auf Englisch oder Deutsch schreibst, mit der Harvard-Methode ist "richtiges Zitieren" garantiert.
Eine Quellenangabe mit der Harvard-Methode im Text besteht aus dem Nachnamen des Autors gefolgt von dem Jahr der Publikation und der/n Seitenzahl/en nach einem Doppelpunkt - das alles in Klammern. Beispiel: (s. Müller 1992: 25-34).
Dabei gilt es die folgenden Besonderheiten zu beachten:
- Wenn ein ganzes Werk zitiert wird, wird die Seitenzahl weggelassen. Wenn der Name des Autors im Text erscheint, wird dieser Name auch nicht in der Klammer wiederholt. Man kann also schreiben: “Hayek (1992) war es, der erstmals den Begriff der “spontanen Ordnung” in die Nationalökonomie einführte.”
- Bei genauer Seitenangabe kommt hinter dem Erscheinungsjahr ein Doppelpunkt und die Seitenzahl (ohne "s."). Zum Beispiel "... Schelsky (1959: 13)".
- Bei zwei Autoren werden die Namen mit einem “und” oder “&” verbunden, z.B. (Jannis und Michalski 1995) oder (Jannis & Michalski 1995). Bei mehr als zwei Autoren wird “et. al.” nach dem ersten Autor gesetzt, also (Becker et al. 2008). Hier kommt kein "s.".
- Wenn zwei Autoren den gleichen Namen haben, Initialen der Vornamen zur Unterscheidung benutzen.
- Bei institutionellem Autor den Namen der Institution so weit ausschreiben, dass Identifizierung möglich ist z.B. "... (Bundesminister für Wirtschaft 1980: 34)"
- Bei einer Neuauflage eines früher erschienenen Werkes werden beide Jahreszahlen (also die der Originalausgabe und der neue aufgelegten Ausgabe) genannt und mit einem Schrägstrich verbunden, z.B. (Engels 1870/1975)
- Wenn ein Autor mehrere Bücher im selben Jahr veröffentlicht hat, werden diejenigen davon, die zitiert werden mit einzelnen Kleinbuchstaben chronologisch sortiert, z.B. (Müller 2005a), (Müller 2005b) etc.
- Mehrere aufeinanderfolgende Literaturhinweise werden durch ein Semikolon getrennt und in eine gemeinsame Klammer eingeschlossen, also "... (Holzkamp 1983; Negt/Kluge 1972; Fricke 1975)"
- Eine Quellenangabe kann überall im Satz stehen, solange es inhaltlich angebracht ist. Am Ende eines Satzes steht sie vor dem Punkt, es sei denn, es wird ein ganzer Block wörtlich zitiert. In diesem Fall steht die Quellenangabe nach dem Punkt.
Zur Literaturliste am Schluss des Manuskripts: Alle zitierten Titel werden alphabetisch nach Autorennamen und je Autor nach Erscheinungsjahr geordnet in einem gesonderten Anhang unter der Überschrift "Literatur" aufgeführt. Hier wird "et al." nicht benutzt, sondern bei mehreren Autoren alle Namen genannt. Der Verlagsname wird in abgekürzter, aber noch verständlicher Form genannt (zum Beispiel statt "Ferdinand Enke Verlag" nur "Enke"). Sonst keine Unterstreichungen, keine Abkürzungen!
Bücher:
Bozi, A., 1917: Soziale Rechtseinrichtungen in Bielefeld. Schriften der Deutschen Gesellschaft für Soziales Recht, Heft 2, Stuttgart: Enke
Statistisches Bundesamt, 1978: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart/Mainz: Kohlhammer.
Zeitschriftenbeiträge:
Baum. R.C., 1977a: Authority codes: The invariance hypothesis. Zeitschrift für Soziologie 6: 5-28.
Baum. R.C., 1977b: Authority and identity - The invariance hypothesis 11. Zeitschrift für Soziologie 6: 349-369.
Orlofsky, J.L./Aslin, A.L./Ginsburg, S.D., 1977: Differential effectiveness of two classification procedures on the Bem Sex Rote Inventory. Journal of Personality Assessment 41: 414-416.
Beiträge in Sammelbänden:
Mulkav, M.J., 1977: The sociology of science in Britain. S. 224-257 in: R.K. Merton/J. Gaston (Hrsg.), The Sociology of Science in Europe, Carbondale: Southern Illinois University Press.
Tonines, F., 1930: Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitute. S. 425-440 in: L. Brauer/A. Mendelssohn-Bartholdv/A. Meyer (Hrsg.), Forschungsinstitute: Ihre Geschichte, Organisation und Ziele. Band 1. Hamburg: Hartung.
Zeitschriftenartikel:
Schneider, Christopher (März 17, 2004). “Die Afghanistan-Frage”. Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Artikel aus einer Online-Enzyklopädie:
Welsch, Max (1906/2005). Das jüdische Bürgertum in Österreich-Ungarn. Jüdische Enzyklopädie 1906. Jewishencyclopedia.com 2005. Stand: 21. Juni 2006.
Richtig zu zitieren ist natürlich nur ein Baustein einer erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeit. Weitere Bausteine erhältst du im untenstehenden Artikel „Erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit – 7 Schritte“.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit - 7 Schritte
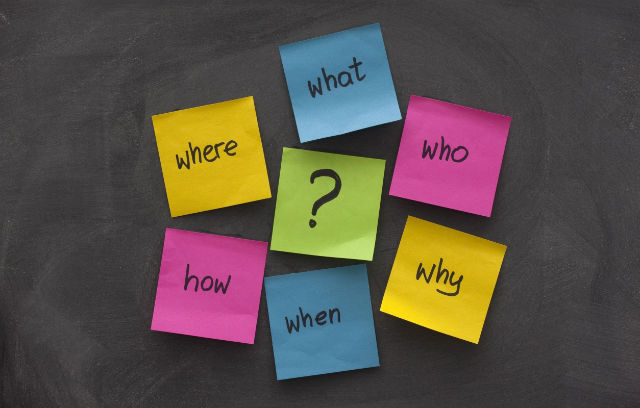 |

Thorsten zeigt dir in 7 Schritten und mit hilfreichen Internetseiten, wie du eine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit schreiben kannst.
Viel Erfolg!
Von: Thorsten
1. Ein Thema wählen und die Forschungsfrage spezifizieren
Oftmals machen Studenten den Fehler, in ihren Abschlussarbeiten ein bestimmtes Thema zu behandeln, das sie vielleicht auch interessiert, ohne sich aber genau zu fragen, welche Frage die Arbeit erörtern soll. Nur ganz selten geben sich Professoren mit einem Thema zufrieden, das bloss vorhandenes Wissen wiedergibt; das kann Wikipedia besser! Von dir als Student wird erwartet, dass du etwas neues schaffst, indem du eigene Gedanken oder Ideen einbringst, vorhandenes Wissen auf deine Weise interpretierst, Wissen mit anderem Wissen kombinierst und optimalerweise sogar neues Wissen produzierst (was aber wegen des hohen finanziellen Aufwandes für Studenten kaum zu bewältigen ist).
2. Hintergrundinformationen suchen
Bestimme mittels Brainstorming einzelne Begriffe heraus, die bei deiner Fragestellung eine grosse Rolle spielen. Schaue dann in Fach-Enzyklopädien nach den Artikeln zu diesen Begriffen, um dir fundiertes Hintergrundwissen anzueignen.
3. Suchprogramme nutzen, um Bücher und sonstige Medien zum Thema zu finden
Fast jede Hochschule hat mittlerweile eine eigene digitale Datenbank, die du nutzen kannst, um den Bibliotheksbestand nach relevanten Medien zu deinem Thema zu durchforsten. Bei der Suche nach den notierten Büchern in den Regalen solltest du auch links und rechts nebenan nach passenden Büchern suchen.
4. Verzeichnisse nutzen, um periodische Artikel (Journals, Magazine, Zeitungen) zu finden
Oftmals führen Hochschulen Verzeichnisse und Jahrbücher, die dir Auskunft darüber geben, wo und wann es einen Artikel zu einem bestimmten Thema gab.
5. Im Internet recherchieren
Neben Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Exalead etc. gibt es eine Reihe von Meta-Suchmaschinen. Dazu gehören:
www.clusty.com
www.dogpile.com
www.surfwax.com
www.copernic.com
Für Akademiker besonders interessant ist scholar.google.com. Hier findest du tausende von wissenschaftlichen Artikeln zu fast jedem Thema.
Zuletzt gibt es noch Online-Verzeichnisse. Diese sind für Akademiker ebenfalls besonders interessant:
www.lii.org
www.infomine.ucr.edu
www.about.com
www.google.com/dirhp
www.dir.yahoo.com
6. Die Ergebnisse der Recherche auswerten
Falls du zuviele oder zuwenige Quellen angehäuft hast, solltest du überlegen, ob deine Forschungsfrage nicht zu generell oder zu speziell gestellt ist. Dein Betreuer wird das am besten einschätzen können, falls du dir unsicher bist.
7. Richtig zitieren
Wie du richtig zitiert erfährst du im unten angefügten Beitrag „Zitieren richtig gemacht“.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
10 Schritte einer erfolgreichen akademischen Karriere

Wer eine akademische Karriere einschlagen möchte, muss strategisch denken und handeln. Gute Noten allein reichen nicht aus. Es kommt darauf an, dass richtige Schritte fachlich, organisatorisch und menschlich eingeleitet werden. In diesem Beitrag sagen wir dir, welche Schritte das unserer Meinung nach sind.
Von: Gary
Grundstudium
1. Gute Noten
Die Grundvoraussetzung für eine akademische Karriere ist eine fachliche Eignung dazu. Als einer von hunderten von Studenten an deiner Fakultät sind Noten das einzige halbwegs objektive und vergleichbare Argument deiner Kenntnisse, welches du bei Professoren oder anderen akademischen Stellen vorweisen kannst.
2. Kontakt zu Professoren suchen
Du wirst niemals gefördert werden, wenn es keinen gibt, der dich fördern möchte. Und niemand kann dich und deine Karriere fördern, wenn niemand dich kennt. Deshalb: Mach dich bekannt! Geh nach Vorlesungen zum Professor und stelle intelligente Fragen. Sei dabei aber nicht schleimig, aufdringlich und nervig sondern höflich, angenehm und ernsthaft interessiert. Stelle die Frage, bedanke dich und geh. Aber tu das nicht allzu oft.
Du kannst ebenfalls in die Sprechstunde deines Professors gehen. Hier solltest du aber die Latte noch höher setzen: Nur wenn du ein wirkliches Problem hast, welches du ohne Hilfe nicht lösen kannst, solltest du in die Sprechstunde gehen. Achte auch hier darauf, dass du nicht zu lange bleibst. Wenn du aber merkst, dass der Professor sich für deine Ideen interessiert und von sich aus Fragen stellt, solltest du die Chance ergreifen um zu zeigen, was du auf dem Kasten hast.
Eine weitere Gelegenheit hervorzustechen ergibt sich in Seminaren. Sei aktiv und achte immer darauf, dass du nicht schlaumeierisch wirkst. Versuche auch möglichst sachlich-objektiv zu sein und behalte deine Meinung (gerade in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern) lieber für dich. Denn der Professor könnte anderer Meinung sein, das wäre nicht unbedingt gut für dein Ansehen bei ihm.
3. Hiwi werden
Mit einer Stelle als Hilfswissenschaftler stehst du mit einem Bein im akademischen Betrieb. Du hast Zugang zu den wichtigen Personen an der Fakultät, zu den Informationsquellen und erlebst Forschung und Lehre hautnah.
Halte deine Augen immer offen nach freien Stellen und bewirb dich gleich an mehreren Lehrstühlen. Bewirb dich mit guten Noten bei denjenigen Professoren, welche dich schon persönlich kennengelernt haben und zeige im Vorstellungsgespräch Begeisterung für ihre Lehrveranstaltungen oder Forschungsschwerpunkte.
Hauptstudium
4. Spezialisierung
Im Grundstudium solltest du ein langsam erkannt haben, welche Themengebiete dich interessieren und welche nicht. Beispielsweise könntest du als Politologe ein grosses Interesse an politischer Philosophie haben und weniger Interesse an Theorien internationaler Beziehungen. Versuche dann im Hauptstudium so viele Kurse wie möglich in diesem Themengebiet zu belegen. In unserem Politologie-Beispiel wären das Kurse wie “Aristoteles´ Ethik”, “Machttheorien” oder “Die politische Philosophie von John Locke”. So erstellst du dir ein Profil und du wirkst glaubwürdig, wenn du dich später um eine Doktoranden-Stelle bewirbst, die sich mit diesem Themengebiet befasst und wenn du dich an einer Universität bewirbst, die besonders stark auf diesem Gebiet ist.
5. Networking
Ein grosses Netzwerk an Professoren hilft dir in mannigfaltiger Hinsicht: Du kannst in Gesprächen inhaltlich von ihnen lernen, sie können dir Karrieretipps geben, dich an Kollegen weiterempfehlen, für Stipendien vorschlagen, zu Konferenzen einladen, wo du deine Arbeit vorstellen kannst und weiter Networking betreiben kannst, und sie können dich im bestmöglichen Fall auch selbst anstellen.
6. Summer Schools
In den Semesterferien finden zu fast jedem erdenklichen Thema Summer Schools auf der ganzen Welt statt, welche den Studenten die Möglichkeit geben, sich in einer Art “Boot Camp” durch Workshops und Vorträge zu einem ausgewählten Thema weiterzubilden. Viele dieser Summer Schools haben das Ziel, bestimmte wissenschaftliche Methoden zu vermitteln, die für spätere Forschungsarbeiten, etwa als Doktorand, hilfreich oder gar erforderlich sind. In vielen Fällen fördern Stipendienstiftungen, der DAAD oder Fakultäten die Teilnahme an Summer Schools oder bezahlen sie sogar ganz - auch die Reisekosten ins Ausland. Deine Professoren werden sicher wissen, an wen du dich wenden kannst, um die Fördermittel zu beantragen.
Summer Schools sind übrigens die beste Gelegenheit für Networking!
7. Auswahl deiner Doktor-Universität
Mache deinen Doktor am besten an einer international hoch angesehenen Fakultät oder an einem guten Lehrstuhl. Dies wird dir enorme Vorteile verschaffen, wenn du später eine Stelle als Professor oder Dozent suchst. International hoch angesehene Fakultäten findest du in internationalen Fach-Rankings oder du kannst deine Professoren einfach dazu befragen. In den USA wird sehr auf die Reputation der Fakultät, an der du deinen Doktor gemacht hast, geschaut, während in Deutschland (und Europa allgemein) Stellen nicht so sehr über solche Formalitäten vergeben werden, sondern vielmehr über persönliche Kontakte und Empfehlungen. Deshalb ist es in Deutschland wichtiger, einen gut vernetzten und einflussreichen Doktorvater zu haben, der dir die nötigen Kontakte und Empfehlungen verschaffen kann. Je nach dem, ob du also eine akademische Karriere in den USA oder in Europa anstrebst, solltest du entweder auf eine in deiner Disziplin hoch angesehene Fakultät gehen oder an einem gut besetzten Lehrstuhl deinen Doktor machen. Beachte, dass die Top-Fakultäten zwar oft aber nicht immer auch an den Top-Universitäten sind. Beispiel: Die University of Illinois liegt in Gesamtrankings weit hinter Elite-Universitäten wie Harvard, Yale, Stanford oder Princeton, jedoch gilt sie in den Politikwissenschaften in der “Public Opinion” - Forschung als absolute Weltspitze. Ein Doktor in diesem Themenfeld von der University of Illinois würde einen guten Job an einer amerikanischen Universität beinahe garantieren.
8. Doktorarbeitsthemen
Wähle ein Doktorarbeitsthema zu einem Themengebiet, das gerade “en vogue” ist, nach der es also auf dem Arbeitsmarkt eine hohe Nachfrage gibt. Durchsuche hierzu Stellenausschreibungen und hör dich in deiner Fakultät und auf Konferenzen um. Beispiele für heisse Forschungsbereiche sind in den Wirtschaftswissenschaften “experimentelle Ökonomik”, in den Rechtswissenschaften “Law and Economics” und in der Anthropologie die Evolutionspsychologie. Innerhalb deines Forschungsbereiches solltest du ein Thema auswählen, bei dem du eine Technik anwendest, die gerade en vogue ist, z.B. wird in der Politologie vermehrt die Netzwerkanalyse angewandt, während in der Volkswirtschaftslehre spieltheoretische Modelle sehr beliebt geworden sind.
9. Mach dir einen Namen
Gib Vorträge und schreibe Artikel in Fachjournals. Sorge so, dass deine Kollegen über dich reden und deine Interessen kennen. So können sie auf dich zukommen, wenn sie dich eines Tages als Redner, Co-Autor oder gar Dozent rekrutieren möchten.
10. Menschlich gut ankommen
Sei immer respektvoll gegenüber den Theorien und Positionen andersdenkender Kollegen. Leg dich insbesondere nicht öffentlich mit ihnen an. Später, wenn du eine sichere Professorenstelle hast, kannst du das alles nachholen.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Wer Ziele hat, erreicht mehr!

Der Spruch „Wer Ziele hat, erreicht mehr.“ klingt ziemlich ordinär, ist aber richtig. Oder ist euch nicht schon mal aufgefallen, dass man, wenn man etwas unbedingt will, auch mehr erreicht? Die englischen Verhaltensforscher Latham und Locke haben herausgefunden, dass Mitarbeiter, die anspruchsvolle, aber realisierbare Ziele haben, deutlich höhere Leistungen erbringen als Mitarbeiter, die ohne Zielvorgaben arbeiten.
Die sogenannte "Goal-Setting-Theorie" lässt sich auch auf das Lernen anwenden. Sowohl in Bezug auf Zeitpläne als auch auf Stoffumfang. Ziele wirken antreibend und können somit helfen erfolgreich zu studieren. Desweiteren lassen sich mit Hilfe von Zielen Ergebnisse besser überprüfen und in den Lernkontext einordnen.
Von: Max
Die Ziele müssen...
1. ...innerhalb deiner Fähigkeiten und Möglichkeiten liegen:
Deine Stärken und Schwächen zu kennen, hilft dir, erreichbare Ziele zu formulieren. Deine Ziele sollten nicht unerreichbar sein und immer deinem Wissensstand entsprechen.
2. ...realistisch sein:
5 neue Vokabeln jeden Tag zu lernen ist realistisch, 60 hingegen nicht machbar, ausser du bist ein Sprachgenie.
3. ...flexibel sein:
Manchmal kommt es anders als man denkt und man muss seine Ziele anpassen. Deshalb ist es wichtig, flexibel zu sein und seine Ziele notfalls ändern zu können.
4. ...messbar sein:
Es ist sehr wichtig, dass deine Ziele messbar sind bzw. sich der Weg der Zielerreichung messen lässt, wie z.B. deine Erfolge beim Speed Reading. Andernfalls ist es schwierig, deine Motivation aufrecht zu erhalten. Wenn beispielsweise dein Ziel ist, 3 Vokabeln täglich zu lernen, dann lass dich nach 1 Woche abhören. Wenn du 21 Vokabeln kannst, hast du dein Ziel erreicht. Falls nicht, musst du dein Ziel deinen Möglichkeiten anpassen und für die nächste Woche 2 Vokabeln täglich ansteuern.
5. ...beeinflussbar sein:
Du solltest die Erreichung deines Ziels unmittelbar beeinflussen können. Dein Erfolg darf nicht von anderen abhängen, da du dich sonst womöglich nicht mit dem Ziel identifizieren kannst und dein Einsatz somit nicht bestmöglich ist.
Um angemessene Ziele setzen zu können, musst du wissen, was wichtig für dich ist und warum. Weiter ist es hilfreich, deine Ziele aufzuschreiben, da du sie sonst aus den Augen verlieren kannst.
Ein Ziel sollte zudem ausdrücken, welche Auswirkungen das Erreichen des Ziels für dich hat. Wenn du z.B. deine Abschlussarbeit geschrieben hast, bist du mit dem Fach fertig und fährst vielleicht in die Ferien. In den meisten Fällen ist die Folge deines Ziels die Belohnung oder motiviert dich.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Fachmessen: Der Turbo für die Job-Suche
 |

Deutschland ist der international führende Standort für Messen und Ausstellungen. Fünf der zehn größten Messegesellschaften der Welt sind hier angesiedelt. Von den global führenden Messen der einzelnen Branchen finden etwa zwei Drittel in Deutschland statt. Wichtigster Pluspunkt der deutschen Messen ist ihre Internationalität: Über die Hälfte der Aussteller kommen aus dem Ausland, davon ein Drittel aus Ländern außerhalb Europas. Eine optimale Gelegenheit für Messebesucher, mit den Firmenvertretern nicht nur über aktuelle Branchen-Entwicklungen und Innovationen zu fachsimpeln, sondern auch die Fühler auszustrecken nach potentiellen neuen beruflichen Herausforderungen.
Job-Suche kompakt
Für Unternehmen sind Messen eines der wichtigsten Instrumente im Marketing-Mix überhaupt. Doch auch für Bewerber, Jobsuchende und Interessierte bieten Fachmessen eine exzellente Möglichkeit, an den Messetagen mit Firmenvertretern verschiedener Unternehmen aus verschiedenen Ländern Kontakt aufzunehmen.
Nirgendwo sonst erlebt man den regionalen mittelständischen Weltmarktführer buchstäblich Wand an Wand mit riesigen Weltkonzernen. Eine effektivere Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen nicht nur über neue Produkte und Trends zu informieren, sondern auch konkret herauszufinden, welche offenen Positionen die Wunscharbeitgeber bieten können, gibt es kaum.
Gerade auf den Leitmessen sind die wichtigen Ansprechpartner vor Ort nicht unbedingt die Personalverantwortlichen der Unternehmen, sondern Geschäftsführer, Vertriebsleiter oder Fachleute aus den Entwicklungsabteilungen. Mit anderen Worten: die Entscheidungsträger in den Unternehmen, die an wichtigen Schlüsselpositionen sitzen und oft schon sehr früh abschätzen können, wann und in welchen Bereichen Vakanzen im Unternehmen entstehen werden.
Zwei Drittel aller offenen Stellen werden nicht öffentlich ausgeschrieben. Auf den Fachmessen gibt es die Möglichkeit, an diese verdeckten Jobs zu kommen und sich damit einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Job-Suche zu verschaffen.
Der Vorteil dabei: Die Job-Suche ist branchenbezogen und verläuft daher auch überaus zielorientiert. Bewerber haben eine optimale Möglichkeit, den eigenen Marktwert im direkten Vergleich mit den Unternehmen einer Branche zu testen.
Vorbereitung ist das A und O
Der Besuch einer Fach-Messe kann also der erste Schritt ins Berufsleben oder zum lang ersehnten Jobwechsel sein. Doch wie überall im Bewerbungsprozess stellt sich der Erfolg ohne eine gründliche Vorbereitung nicht ein.
Neben einer groben Vorab-Selektion von Unternehmen, mit denen man unbedingt sprechen will und über deren Produkte man sich im Vorfeld im Internet einen kurzen Überblick verschafft, muss vor allem die persönliche Bestandsaufnahme im Fokus der Vorbereitung auf den Messebesuch stehen.
Die zehn Kernfragen lauten:
1. Was wollen Sie beruflich erreichen (kurz-, mittel- und langfristig)?
2. Wovon träumen Sie beruflich (Was motiviert Sie? Was macht Ihnen Spaß?)?
3. Was sind Ihre Stärken?
4. Wo liegen Ihre Grenzen?
5. Welche fachlichen Qualifikationen bringen Sie mit?
6. Was unterscheidet Sie von anderen Bewerbern?
7. Welche Eigenschaften sollte der potentielle Arbeitgeber mitbringen?
8. Was erwarten Sie von Ihrem potentiellen Arbeitgeber?
9. Wie sollte Ihr optimales Arbeitsumfeld aussehen?
10. Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Messebesuch? Was muss passieren, damit Sie Ihren Messebesuch im Nachhinein als erfolgreich verbuchen können?
Je intensiver Sie sich darüber Gedanken machen und je detailgenauer Ihre Antworten ausfallen, umso leichter wird es Ihnen später fallen, im konkreten Gespräch mit den Firmenvertretern Ihre beruflichen Wünsche zu äußern und festzustellen, ob die deckungsgleich mit den Karriere-Chancen sind, die das Unternehmen bieten kann.
Selbstmarketing – die ersten 30 Sekunden entscheiden
Fachmessen sind für viele Unternehmen das geschäftliche und soziale Highlight des Jahres und viele Firmen „rüsten“ daher richtig auf und präsentieren sich mit beeindruckenden Ständen auf vielen hundert Quadratmetern.
Auf einem solchen Stand den Überblick zu behalten und herauszufinden, wer für was zuständig ist, ist eine Kunst. Standhaftigkeit und Durchsetzungskraft ist hier gefragt, bis man den richtigen Ansprechpartner gefunden hat.
Erster Anlaufpunkt eines „Mega-Standes“ ist in jedem Fall der „Info-Point“. Dort gibt es nicht nur die so beliebten Give-Aways, sondern dort finden Sie im Regelfall eine große Anzahl freundlicher Mitarbeiter/innen, die Ihnen helfen können, einen für Sie zuständigen Gesprächspartner ausfindig zu machen.
Haben Sie den richtigen Ansprechpartner gefunden, liegt Ihre Kunst nun in der Überzeugungskraft – und viel Zeit haben Sie dafür nicht, denn hunderte Besucher werden an den Messeständen abgefertigt und nach der ersten Stunde weiß das Standpersonal häufig nicht mehr, mit wem es schon alles gesprochen hat. Viele Gespräche sind darüber hinaus völlig unproduktiv und dauern viel zu lange, weil der interessierte Messebesucher nicht auf den Punkt kommt.
Damit Ihnen das nicht passiert und Sie schon in den ersten Sekunden Ihres Bewerbungsgesprächs am Messestand einen guten Eindruck hinterlassen, gibt es ein wirkungsvolles "Geheimrezept" für Ihre Selbstpräsentation: den Elevator Pitch - eine überzeugende Präsentation (Pitch), die nur soviel Zeit in Anspruch nehmen darf, wie eine 30-90 sekündige Fahrt mit dem Fahrstuhl (Elevator).
Ob in einer Vorstellungsrunde, am Telefon oder bei einem Gespräch am Messestand - Sie haben meist nicht mehr als 30 Sekunden Zeit, um sich und das was Sie tun vorzustellen. Schaffen Sie es in dieser kurzen Zeit, Ihren Gesprächspartner neugierig zu machen auf die „Marke Ich“?
Wesentlich beim Elevator Pitch ist die emotionale Ansprache. Wecken Sie bei Ihrem Gesprächspartner positive Emotionen durch Ihre Begeisterung, Ihr Interesse und Ihre Neugier, dem Unternehmen, den Produkten oder der Branche gegenüber.
Das schaffen Sie aber nur, wenn Sie sich im Vorfeld Gedanken zu den zehn Kernfragen gemacht haben, deren Antworten nun genau an dieser Stelle zum Einsatz kommen. Denn auch wenn wir oft von einer Sekunde auf die andere in Aktion treten müssen, können wir nur dann im Handumdrehen überzeugen und begeistern, wenn wir die richtigen Argumente bereits parat haben. Egal, wie interessant Sie Ihre fachlichen Qualifikationen verkaufen, Ihr Gesprächspartner wird Ihnen nur dann Gehör schenken, wenn Sie auch als Person überzeugen.
Antworten Sie im Elevator Pitch auf die – oft unausgesprochene – Frage, warum Ihr Gesprächspartner ausgerechnet mit Ihnen zusammenarbeiten bzw. an Sie denken sollte, wenn die entsprechende Vakanz entsteht. Bieten Sie Ihrem Gesprächspartner einen klaren Vorteil.
Neben der fachlichen Qualifikation beeindrucken wir einen Zuhörer im persönlichen Gespräch nämlich mit echten Gefühlen, Authentizität und Persönlichkeit. Sie müssen begeistern und selbst begeistert sein, von dem, was Sie machen oder machen wollen.
Und auch dabei hilft der Besuch einer Fachmesse. Hier werden Innovationen lebendig, hier atmet die Zukunft einer Branche – und nichts ist spannender und mitreißender. Leichter kann ein positiver Gesprächseinstieg kaum noch werden.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Lernzeit-Management

Oh nein! Die Klausur ist schon morgen! Verdammt...
In jedem Semester das gleiche: Du nimmst dir in der 1.Woche vor, es im neuen Semester nicht wieder schleifen zu lassen, früh mit dem Lernen anzufangen und dann zum Ende entspannt den Prüfungen entgegenzusehen. Wie mit den meisten Vorsätzen, klappt es auch mit dem gelungenen Zeitmanagement nicht wirklich.
Doch zum Glück gibt es immer Lösungen.
Von: Max
Ich zeige dir hier 3 einfache Schritte, wie du deine Lernzeit optimal strukturieren kannst. Einen Haken hat die Sache aber: Du musst am Anfang des Semesters damit beginnen und darfst es nicht schleifen lassen!
1. Schritt: Erstelle einen Semesterkalender
Erstelle zu Beginn des Semesters einen Kalender, den du aber während des Semesters auch immer wieder aktualisierst.
- Schreibe deine Klausur- und Abgabetermine und anstehende Projekte auf
- Schreibe auf, wann und wo welcher Kurs, welches Blockseminar und welche Exkursion stattfindet
- Trage auch deine Aktivitäten ausserhalb der Uni in den Plan ein
Der Semesterkalender dient als grobe Übersicht. Mit seiner Hilfe kannst du dir ungefähr dein Semester einteilen, weisst wann die grosse Klausurenphase beginnt und ab wann du nicht mehr jobben solltest bzw. einfach weniger Zeit hast. Abgesehen davon lassen sich Praktika und Urlaub besser planen.
2. Schritt: Fertige Wochenkalender an
Nimm dir an jedem Sonntag 10 Minuten Zeit und bereite deinen Wochenkalender vor. Folgende Punkte gehören hinein:
- Notiere, welche Kurse du an welchem Tag hast
- Schreibe deine Aktivitäten ausserhalb der Uni auf
- Lege eine To-Do-Liste mit den wichtigsten Erledigungen der folgenden Woche an
- Notiere freie Zeiträume zum studieren
Der Wochenkalender schafft die Grundlage für deine Wochenplanung. Du weisst genau, wann du Zeit hast und wann nicht. Im ersten Augenblick klingt das wenig spontan, in Wirklichkeit kannst du aber auf diese Weise deine Woche bestens ausnutzen.
3. Schritt: Benutze einen Tagesplaner!
Der Tagesplaner hilft dir, den Unitag gut organisiert durchzustehen. Du solltest ihn am Abend vor dem nächsten Tag kurz aufschreiben. Hake ab, wenn du Aufgaben aus dem Planer erledigt hast. Und folgendes gehört hinein:
- Übertrage die Notizen aus deinem Wochenkalender in den Tagesplaner
- Ergänze um die Dinge, die du am Vortag nicht geschafft hast
- Trage die Aktivitäten ausserhalb der Uni ein, die du am Folgetag machst
Im Zeitalter von Smartphones und Internet nutzen immer mehr Schüler und Studenten multimediale Anwendungen. Der Kalender muss also natürlich nicht aus Papier sein. Ganz im Gegenteil- das Handy ist ständig dabei und Laptops werden immer kleiner und handlicher. Zudem lassen sich die elektronischen Kalender leichter anpassen und synchronisieren.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Stressfaktoren erkennen

Es kommt dir manchmal so vor, als gäbe es nichts, was du gegen den dauernden Stresslevel machen kannst. Die Uni überhäuft dich mit Deadlines, das Geld ist immer zu knapp, der Druck, was du nach der Uni machen sollst, nimmt von Tag zu Tag zu und zu deinen Hobbies kommst du sowieso nie. Es gibt viele verschiedene Ansätze, mit Stress klarzukommen oder Stressempfinden zu reduzieren.
Von: Sebastian
Einer der grundlegendsten Ansätze beschäftigt sich mit der persönlichen Wahrnehmung von Stress. Übermässig gestresste Menschen setzen Stress mit etwas von aussen wirkendem gleich, das auf einen einwirkt und auf das man keinen Einfluss hat. Du hast jedoch viel mehr Kontrolle über deinen Stresspegel als du denkst! In Wirklichkeit ist die Einsicht, Kontrolle über sein Leben zu haben, der Grundstein des Stressmanagements.
Stress zu managen heisst, Kontrolle zu übernehmen. Du hast die Kontrolle über deine Gedanken und Emotionen, über deinen Stundenplan, deine Umwelt und über die Weise, auf welche du mit Problemen umgehst. Dein höchstes Ziel in dieser Hinsicht ist ein ausgeglichenes Leben, mit genügend Zeit für Studium, Sozialleben, Freizeit – plus die Belastbarkeit zu erlangen, unter Druck standzuhalten und Herausforderungen zu meistern.
Um diese Ziele zu erreichen ist es wesentlich, die Stressfaktoren in deinem Leben zu erkennen. Oft ist das aber nicht so einfach wie man sich das denkt. Die wahren Quellen deiner Gestresstheit sind nicht immer offensichtlich erkennbar, und es ist nur zu einfach, eigene stressverursachenden Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu übersehen. Klar, du weisst, dass Examenstermine und Abgabedeadlines für Hausarbeiten dir Sorgen bereiten und dich stressen, doch vielleicht sind die Quellen deines Deadlinestresses eher dein Aufschieben und ein schlechtes Zeitmanagement als die Anforderungen der Uni.
Findest du folgende Verhaltensmuster oder Ausreden bei dir wieder? Oft sind sie ein Grund für gefühlten ständigen Stress:
- Erklärst du dir deinen Stresslevel mit aktuellen Ereignissen („Ich habe nur gerade sehr viel um die Ohren“), obwohl du dich nicht an deine letzte Verschnaufpause erinnern kannst?
- Begründest du Stress als Teil deines Studiums oder deiner Arbeit („Der Kurs/der Fachbereich ist extrem fordernd, da ist man immer unter Druck“) oder als Teil deiner Persönlichkeit („Ich bin einfach ziemlich hektisch, das ist alles…")?
- Machst du andere Leute oder Ereignisse für deinen Stress verantwortlich und findest dies als völlig normal?
Die Sichtweise ist massgeblich. Um Stress zu verringern, musst du Verantwortung anerkennen, deinen Stresspegel kontrollieren zu können. Wenn du Stress als etwas siehst, das jenseits deiner Kontrolle liegt, wirst du zum Punchingball deines Umfeldes. Übungen, Stress zu kontrollieren, und wirkungsvolles Zeitmanagement werden dir helfen, diese Grundlagen in die Tat umzusetzen.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Stressbewältigung während des Studiums

Die Zahl der Studenten, die unter stressbedingten Symptomen leiden, steigt immer mehr. An vielen Universitäten verzeichnen die psychologischen Beratungsstellen einen stetigen Zuwachs von Studenten, die an Stress leiden. Die Zahl hat sich in den letzten 5 Jahren fast verdoppelt. Der Grund für die stressbedingten Symptome ist klar: Zeitdruck, Versagensangst, Erschöpfungs- und Überforderungssyndrome und finanzielle Sorgen.
Von: Thorsten
Stress kannst du oft nicht verhindern, aber es gibt Möglichkeiten der Stressbewältigung. Zunächst bietet dir jede Universität eine psychologische Beratungsstelle. Die ausgebildeten Mitarbeiter kennen das Problem genau und können dir nützliche Informationen und Adressen geben. Viele Studenten greifen inzwischen zu Medikamenten zur Stressbewältigung. Wichtig ist, dass du stets einen Arzt konsultierst, bevor du zu irgendwelchen Mitteln aus der Apotheke greifst. Medikamente können die Symptome und den Stress jedoch meistens nur kurzfristig reduzieren und sollten daher nur als äusserstes Mittel zur Stressbewältigung dienen.
Es hilft sehr, einen geordneten Ablauf während deiner Studienzeit zu haben. Wenn du deinen Tagesablauf organisierst und dich an deine eigenen Regeln hältst, kannst du Stress vorbeugen. Das Lernen vor Prüfungen kannst du nicht verhindern, aber du kannst dir zum Beispiel einen freien Nachmittag gönnen und dich körperlich betätigen oder auf eine andere Art abschalten, beispielsweise mit einem Kinobesuch oder einem Treffen mit Freunden. Auch der Austausch mit anderen Studenten ist sehr konstruktiv.
Sport ist ein guter Weg zur Stressbewältigung. Viele Universitäten oder Sportvereine bieten eine reichhaltige Auswahl an verschiedensten Sportarten. Durch Bewegung wird dein Kreislauf in Schwung gebracht, du kannst abschalten und neue Kraft tanken.
Zur Stressbewältigung kannst du auch an einem speziellen Coaching teilnehmen. In den Workshops lernst du, besser mit Stress umzugehen. Ein solches Coaching ist besser als Medikamenteneinnahme und dauert oft nur wenige Stunden.
Das Studentenwerk deiner Uni kann dir Hilfestellen vermitteln. Welche konkreten Massnahmen du ergreifen kannst, um Stress langfristig zu bewältigen, findest du in den jeweiligen Artikeln.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfolgreich studieren - 8 Merkmale

Studenten mit Erfolg haben gute Lernstrategien bzw. gehen nach bestimmten Techniken vor und wenden diese beim Lernen an. Wir haben 8 Techniken für euch zusammengetragen:
Von: Max
1. In Massen:
Erfolgreiche Studenten studieren in Massen. Sich mit zu viel Arbeit zuzuschütten hilft nicht. Ganz im Gegenteil: man hat das Gefühl, gar nicht voranzukommen und gibt schnell auf. Daher sollte man sich das Lernpensum immer in Massen und durchführbar einteilen.
2. Immer zur selben Zeit:
Routinen helfen vor allem beim Lernen, da sich der Körper dem Lernen als Teil des normalen Tagesablaufs anpasst. Die Aufwärmphase, bis man auf “geistiger Betriebstemperatur“ ist, verkürzt sich und man kann direkt loslegen mit dem Lernen.
3. Setze Ziele:
Wenn man weiss, was man will, ist man erfolgreicher. Ziele helfen beim Studieren und reduzieren die Gefahr, den Faden zu verlieren. Vor allem wenn man viel Stoff zu bewältigen hat, ist es gescheit, vorher zu überlegen, bis wann was erledigt sein soll.
Genauso wichtig wie die Ziele zu bestimmen ist, deren Überprüfung. Hast du geschafft, was du dir für die Lernsession vorgenommen hast, oder musst du dir beim nächsten Mal etwas weniger vornehmen?
4. Folge deinem Lernplan:
Stell sicher, dass du wirklich dann anfängst, wann du es auch geplant hast, und nicht Überraschungen in Form von Freunden oder deiner Lieblingsserie anstehen, um dich abzulenken. Lernen ist in vielen Fällen nicht so schön wie Hobbies oder Freizeit, kann, wenn du es durchdacht einteilst, aber weniger belastend sein.
5. Konzentriere dich zuerst auf die schwierigsten Probleme oder Aufgaben:
Wenn du mit den schweren Aufgaben anfängst, bist du noch frisch und dein Kopf ist fit. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir der richtige Weg einfällt und du produktiv bist, ist viel höher. Die leichteren Aufgaben kannst du danach angehen und dich somit “belohnen“.
6. Suche Hilfe:
Es gibt Aufgaben, die man zwar alleine lösen könnte, jedoch nicht ohne sich die Haare zu raufen oder wutentbrannt Sachen durchs Zimmer zu werfen. Zögere nicht, Mitstudenten,Tutoren oder Professoren um Rat zu fragen. Auch Lerngruppen machen für bestimmte Fächer Sinn.
7. Mach Pausen:
Wenn du während der Lernerei merkst, dass deine Konzentration abnimmt oder du müde wirst, mach eine viertel Stunde Pause und geh raus. Bewege dich und entspanne. Besonders deine Augen brauchen Abwechslung. Schau auf entfernte Gegenstände und dann wieder auf nahe. Du wirst merken, wie es hilft.
8. Wiederhole den Stoff:
Jede einzelne Vorlesungs- oder Unterrichtsstunde nachzuarbeiten ist natürlich nicht möglich. Aber einfach kurz überfliegen, wenn nicht zuhause, dann eben vor der nächsten Stunde, hilft dir, dich schneller auf die neue Stunde einzustellen. Die besten Lehrer wiederholen zu Beginn einer neuen Stunde den Stoff der letzten Stunde noch mal kurz. Das tun jedoch nicht alle. Besonders an der Uni wird selbstständiges Nacharbeiten und Vorbereiten vorausgesetzt. Wäge ab, für welche Fächer du mehr und für welche weniger machen musst.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Stressabbau durch Sport
 |

Sicher kennst du das auch: Das lange Stillsitzen in der Vorlesung, die hohe Konzentration bei den Seminaren, das stundenlange Vorbereiten auf Klausuren. Das alles ist Stress pur! Doch wie soll man den Stress kompensieren bzw. abbauen? In Ruhe runterkommen geht meistens gar nicht so gut. Die Folge: Du bist schlecht drauf und zu Leuten, die gar nichts dafür können, bist du einfach grantig. Oft lebt man als Student noch in einer WG oder vielleicht im Studentenwohnheim, dann kommt zum Stress im Studium auch noch privater Ärger dazu. So langsam wächst dir alles über den Kopf. Doch es gibt Lösungsansätze, auf die man nur meistens selbst nicht kommt...
Von: Thorsten
Sport heisst hier das Zauberwort. Nicht gleich abwinken, es funktioniert tatsächlich, so reicht vielleicht schon ein längerer Spaziergang mit festem Schritt oder Jogging und Walking, aber auch Schwimmen. Dies sind gute Methoden für Stressabbau durch Sport. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen, die ausgeglichen und mental entspannt sind, Stress viel besser wegstecken als unausgeglichene Menschen. Wie du sicher weisst, laufen im Körper ständig chemische Prozesse ab, die deinen Gemütszustand beeinflussen. Jetzt ist es so, dass sportliche Aktivitäten bestimmte biochemische Prozesse im Körper auslösen. Dabei wird im Körper ein Glückshormon, das sogenannte Endorphin, ausgeschüttet, was dich stressresistenter macht. Damit wird Stress abgebaut, aber auch ein Ausgleich zum Studium und zur mangelnden Bewegung wird mit dem Stressabbau durch Sport erreicht. Joggen empfiehlt sich am ehesten, da man alleine, spontan, fast überall und ohne grosse Ausrüstung loslegen kann. Nun ist Joggen nicht Jedermanns Sache, aber wie eingangs schon erwähnt auch ein strammer Spaziergang kann schon ein Ausgleich sein. Beim Gehen -wie bei allen sportlichen Aktivitäten- ist die Atmung besonders wichtig. Wer sich aber lieber schneller bewegt, sollte langsam beginnen und aufwärmen und Dehnübungen machen, die senken das Risiko schmerzhafter Ausfallerscheinungen. Joggen ist auf weicheren Böden wesentlich schonender als auf hartem Pflaster. Geeignet sind Laufbahnen, Waldböden aber auch Sandstrände, für die Bewohner der Küstenregionen, an Nord- und Ostsee natürlich leicht zu erreichen, ein idealer Ort, um sich sportlich zu betätigen. Wer sich nicht so gerne an Land bewegt, für den ist Schwimmen eine gute Möglichkeit, Sport zu treiben. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, sollte man eine gewisse Frequenz auch beim Sport einhalten.
Beim Stress unterscheiden die Mediziner zwischen Disstress -negativer Stress- und Eustress -positiver Stress. Eustress ist der Stress, der eher als positiver Handlungsdrang bezeichnet werden kann. Diese Art Stress kann förderlich sein, da man produktiv und motiviert arbeitet. Zusätzlich fühlt sich diese Art von Stress nicht negativ an, man fühlt sich eher positiv gepusht. Distress hingegen ist der Stress, den du vermeiden möchtest. Sport und die hierbei ausgeschütteten Endorphine helfen, Distress abzubauen. Bei regelmässiger sportlicher Betätigung trainiert man durch die entsprechenden Änderungen im Hormonspiegel die Stressresistenz des Körpers. Das Hauptproblem beim Sport ist wie üblich: Sport überhaupt zu machen! Sich einmal zu überwinden ist Gold wert, denn nach dem Sport wirst du spüren, wie der Stress von dir abfällt. Wenn man sich also einmal entschieden hat, was gegen den Stress zu tun, hat man schon den 1.Schritt in die richtige Richtung gemacht.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Wo steht deine Uni im Uni-Ranking?

Im Kampf um die besten Jobs kommt es neben persönlichen Qualitäten vor allem darauf an, eine solide fachliche Ausbildung vorzuweisen. Woher aber wissen Personalchefs, wo die Top-Mitarbeiter von morgen ausgebildet werden? Auch angehende Studenten stellen sich diese Frage immer häufiger. Uni-Rankings sollen genau das beantworten. Im englischsprachigen Raum gibt es sie schon lange und seit einigen Jahren werden sie auch in Deutschland von diversen Organisationen durchgeführt. Wir stellen die wichtigsten Rankings vor:
Von: S4S-Team
Nationale Rankings:
- Im grossen Hochschulvergleich von Karriere waren besonders praxisnahe Universitäten und Hochschulen ganz oben. Welche Hochschulen das sind, kannst du im Artikel sehen.
- Eines der wichtigsten und umfassendsten Studien zu der Qualität von einzelnen Studiengängen in Deutschland wird jedes Jahr vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) durchgeführt. Jedoch legt es keine Ranglisten vor, sondern teilt die Studiengänge nur in Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe ein. Die Ergebnisse siehst du hier.
- Das Humboldt-Ranking gibt Auskunft, welche Hochschulen bei ausländischen Spitzenwissenschaftlern ausgesprochen beliebt sind, indem es die Forschungsaufenthalte der von der Alexander-von-Humboldt Stiftung geförderten Stipendiaten und Preisträger an deutschen Forschungseinrichtungen zählt. Das Ranking, aufgeteilt nach Fachrichtung, findest du hier.
- Das für BWL-er wohl ausführlichste Ranking wird vom Handelsblatt erstellt. Es bewertet neben deutschen auch Schweizer und österreichische Hochschulen und Business Schools, wobei die Schweizer wie erwartet äusserst gut abschneiden, wie du hier siehst.
- Das DFG-Förder-Ranking zeigt, welche Hochschulen die meisten Forschungsgelder von der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft (DFG) für sich gewinnen konnten. Es gilt als Indikator dafür, wie viel relevante Forschung an einer Hochschule betrieben wird, was sich allerdings stark auf die Reputation der jeweiligen Hochschule auswirkt. Hier die Ergebnisse.
Internationale Rankings:
- Die britische Zeitschrift "Times Higher Education" veröffentlicht jährlich ein Ranking der weltweit 500 besten Hochschulen. Die bestplatzierten deutschen Unis 2009 waren die TU München (Platz 55), Heidelberg (57), FU Berlin (94) und die LMU München (98). Wer zur absoluten Weltspitze gehört, siehst du hier.
- Das Webometrics Ranking of World Universities erstellt jährlich ein Ranking von 17.000 Universitäten anhand der vorhandenen Menge an Informationen, die von den Universitäten selbst oder über sie im Internet kursieren. Wie du hier siehst, schneiden in diesem Ranking von den deutschen Universitäten die FU Berlin (84) und die Uni Hamburg (99) am besten ab.
- Das Academic Ranking of World Universities (ARWU) wurde erstmals im Juni 2003 vom Center for World-Class Universities und dem Institute of Higher Education der Shanghai Jiao Tong Universität, China, veröffentlicht. Seitdem erscheint jedes Jahr ihr vielbeachtetes Ranking der weltbesten Universitäten. In diesem Ranking schneiden von den deutschen Unis die LMU München (55), die TU München (57) und die Uni Heidelberg (63) am besten ab.
All diese Rankings bieten eine gute Orientierung, ihnen sollte aber nicht allzu viel Bedeutung beigemessen werden. Es stimmt, dass die Reputation von Universitäten sich besonders aus solchen Rankings ergibt. Für die Jobsuche könnte der Besuch eines der Top-Unis in der Tat sehr vorteilhaft sein. Viel wichtiger ist es aber, fachlich erstklassig ausgebildet zu sein und in vielen spezialisierten Feldern können das kleinere, unbekanntere Hochschulen genauso gut oder besser leisten als die grossen Namen. Erst recht wer eine akademische Karriere plant, sollte sich vorher genau informieren, welche Universitäten in dem angestrebten Forschungsbereich top sind, und seine Hochschulwahl danach richten.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Der TOEFL Test - 10 Fragen und Antworten
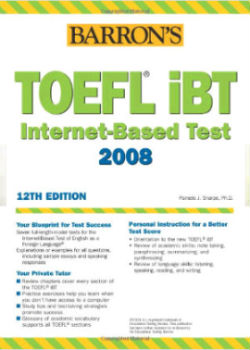
Spielst du mit dem Gedanken, im englischsprachigen Ausland zu studieren? Wenn ja, dann wirst du mit grosser Wahrscheinlichkeit den sogenannten TOEFL-Test über dich ergehen lassen müssen. Denn fast alle Hochschulen in den USA, Kanada, Grossbritannien, Neuseeland und Australien verlangen den Test als Nachweis deiner Englisch-Qualifikationen. Doch was sollte man zum TOEFL-Test alles wissen? Wir sagen es dir.
Von: Thorsten
Was ist TOEFL?
TOEFL steht für “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) und ist ein standardisierter Test, in dem die Englischkenntnisse von Nicht-Muttersprachlern geprüft werden. Der Test wird von den meisten Universitäten im englischsprachigen Raum zur Zulassung vorausgesetzt.
Was wird im TOEFL getestet?
Der Test besteht aus den folgenden Abschnitten:
1. Reading Comprehension, 60-100 Minuten, 44-60 Fragen (multiple choice)
2. Listening Comprehension, 60-90 Minuten, 30-50 Fragen (multiple choice)
3. Speaking, 20 Minuten, 6 Fragen (mündliche Antwort über Mikrofon)
4. Written Expression, 55 Minuten, 2 Fragen (eigenständigen Text schreiben)
In jedem dieser Abschnitten wird sowohl auf die Ausdrucksfähigkeit, also die verwendeten Vokabeln, aber auch auf die korrekte Grammatik geachtet.
Wie lange ist ein TOEFL-Ergebnis gültig und wie oft kann ich den Test machen?
Das Ergebnis ist bis zu 2 Jahre nach dem Testtermin noch gültig und der TOEFL kann beliebig oft wiederholt werden.
Wie werde ich bewertet?
Für jeden Abschnitt gibt es max. 30 Punkte. So können insgesamt 120 Punkte erreicht werden. Du kannst im TOEFL-Test nicht durchfallen. Du bekommst eine Punktezahl bescheinigt, mit der du dich dann an den Hochschulen bewerben kannst.
Wie viele Punkte verlangen die amerikanischen Universitäten?
Im Schnitt verlangen amerikanische Universitäten ca. mindestens 70 Punkte. Hier sind einige Beispiele:
University of Wisconsin - 61 Punkte
Brown University, Fachbereich Physik - 61 Punkte
University of California, Los Angeles, Master und Doktorstudiengänge - 87 Punkte
University of Washington, Fachbereich Kommunikation - 70 Punkte
University of Missouri - 61 Punkte
Wo kann ich den TOEFL-Test machen?
Der Test findet in folgenden Städten statt:
Aachen, Augsburg, Berlin, Bonn, Bünde, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt (Eschborn), Frankfurt am Main, Güby, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Mainz, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Oestrich-Winkel, Osnabrück, Paderborn, Rostock, Schönebeck. Stuttgart, Tübingen.
Wie oft findet der Test statt?
Das ist unterschiedlich. An den grösseren Hochschulorten findet der Test bis zu 5 mal pro Monat statt. Die genauen Termine erfährst du auf der TOEFL-Website www.de.toefl.eu.
Wann erfahre ich das Ergebnis?
Etwa 2-4 Wochen nach dem Test erfährst du das Ergebnis per Post.
Wie viel kostet die Teilnahme am TOEFL?
225 US-Dollar.
Wie melde ich mich zum TOEFL-Test an?
Du kannst dich unter www.de.toefl.eu online anmelden.
Nun kann es also losgehen mit der Vorbereitung für den TOEFL-Test. Für weitere Tipps zum TOEFL-Test empfehlen wir das Buch von Pamela Sharpe, welches das beste Preis-Leistungs-Verhätnis bietet (siehe Bild).
Viel Glück!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
11 Tipps eines Absolventen, um glücklich und erfolgreich zu studieren

Mit dem Studium beginnt ein neuer Lebensabschnitt und damit auch eine grosse Herausforderung. Um das meiste aus dem Studium herauszuholen, kann es hilfreich sein, mit Absolventen zu sprechen, denn sie können dich auf typische Fehler hinweisen und dir Tipps geben, wie du diese vermeidest. Aus meiner Sicht - ich habe bis Ende 2008 VWL und Politik studiert - haben Studenten die besten Voraussetzungen für ein glückliches und erfolgreiches Studium, wenn sie die folgenden Tipps befolgen:
Von: Gary
1. Das 1. Jahr ernst nehmen
Die meisten Studiengänge sind so aufgebaut, dass das erste Jahr besonders anspruchsvoll und lernintensiv ist, um schon früh festzustellen, wer für das Studium geeignet ist und wer nicht. Deshalb solltest du in dieser Zeit soviel wie möglich Motivation und Energie aufbringen. Sei dir darüber im Klaren, dass es im 2.Jahr und danach mit hoher Wahrscheinlichkeit leichter wird. Aus 3 Gründen: die harten, "aussiebenden" Kurse hast du schon im 1.Jahr belegt, du hast dich jetzt eingelebt und bist mit dem Stoff vertrauter, und du hast mehr Wahlkurse. Falls du also gerade im 1.Jahr bist und verzweifelst, Augen zu und durch!
2. Sich fragen, was man sich vom Studium verspricht
Du wirst viel motivierter sein, wenn du weisst, wofür du das alles eigentlich machst. Möchtest du eines Tages für eine bestimmte Firma arbeiten? Möchtest du einfach nur viele Optionen haben, wenn du die Uni verlässt? Oder hast du einfach nur Spass am Lernen? Nur wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, wirst du das volle Leistungspotenzial aus dir schöpfen können.
3. Keine Angst vor einem Abbruch haben
Wenn du nach 2 Semestern unglücklich über dein Studium bist, wechsle die Hochschule oder das Fach, je nach dem, wo das Problem liegt. Es lohnt sich. Selbst wenn du das Fach wechselst, wirst du vielleicht einige Scheine anrechnen lassen können, aber selbst wenn nicht, ein Neuanfang bedeutet nicht, dass du dein 1.Jahr verschwendet hast. Im Gegenteil: durch das 1.Jahr hast du gelernt, was du wirklich wirst und ausserdem hast du bestimmt auch gut gefeiert!
4. Wissen, worauf es ankommt
Die allermeisten Studenten machen nicht zu wenig sondern zu viel für das Studium (jedenfalls war das in meinen Fächern Politologie und VWL der Fall). Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern nur das, was dich entweder interessiert oder was höchstwahrscheinlich in einer Prüfung oder Hausaufgabe abgefragt wird. Aber selbst in letzterem Fall solltest du gründlich abwägen, ob du dich wirklich so sehr mit dem Material beschäftigen möchtest bzw. ob es sich für den Aufwand wirklich lohnt.
Beispiel 1: Du bist im Grundstudium und sollst in einem Kurs eine Hausarbeit schreiben, deren Note 5 % deiner Gesamtnote ausmachen wird und die wiederum nur 10% der Kursnote ausmacht. Insgesamt ist die Hausarbeit also nur 0,5% der Gesamtnote wert. Nehmen wir an, dass du mit viel Aufwand eine 1,5 bekommen würdest. Ohne Aufwand bekommst du hingegen eine 3,0. Du hättest also deine Gesamtnote um 0,15% verbessert. Wenn dieser Aufwand daraus besteht, dass du eine Woche lang recherchieren und schreiben müsstest, obwohl du in der gleichen Zeit für eine überaus wichtige Klausur lernen könntest, oder eigentlich die Bewerbungsfristen für Auslandsaufenthalt und Stipendien einhalten musst, dann solltest du unbedingt sorgfältig überlegen, ob es das wert ist.
Beispiel 2: Du bekommst jede Woche Lesematerial von deinen Dozenten, das nicht überaus erforderlich ist, um das behandelte Thema zu verstehen, sondern nur ergänzend ist. Lies diese Texte tatsächlich nur, wenn sie dich interessieren. Falls Inhalte aus den Texten mal doch in den Prüfungen abgefragt werden sollten, solltest du die Texte rechtzeitig zusammenfassen (am besten auf Karteikarten) aber noch nicht auswendig lernen, denn oft vergisst man es sowieso bis zur Prüfung und muss es dann nochmals lernen. Doppeltes Lernen ist verschwendete Zeit, die du hättest viel produktiver in dein Studium investieren können.
5. Zusatzkompetenzen erlernen
Nach dem Studium werden Arbeitgeber nicht nur auf deine fachspezifischen Kenntnisse schauen, sondern auch bestimmte Zusatzqualifikationen verlangen oder zumindest sehr gerne sehen. Hier einige Vorschläge: Excel, Powerpoint, ein Statistikprogramm (etwa SPSS oder Stata), ein Content Management System (etwa Joomla oder Wordpress), HTML, ein Grafik-Programm (etwa Photoshop oder InDesign) oder Fremdsprachen.
6. Das Studium ist mehr als nur ein Studienfach
Das Studium bietet dir eine einmalige Gelegenheit, deine Allgemeinbildung aufzupeppen. Im Vorlesungsverzeichnis wirst du viele spannende Vorlesungen finden, in die du dich einfach mal reinsetzen kannst. Zudem finden an allen Hochschulen immer wieder Sonderveranstaltungen statt, die du besuchen kannst, zum Beispiel Vorträge, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Workshops. Hier kannst du ganz ohne Druck lernen.
7. Nicht nur für die Uni leben
Es macht viel Sinn, dich auch fernab der Universität zu beschäftigen. Aus 2 Gründen: Wenn du eines Tages die Uni verlässt, wirst du auch weiterhin ein Hobby und ein soziales Netzwerk haben wollen. Ausserdem ist es sehr hilfreich, einen Ausgleich zur Uni zu haben.
8. Mit Professoren sprechen
Du bist als Student in der glücklichen Position von absoluten Experten umgeben zu sein. Nutze diese Gelegenheit und stell nach der Vorlesung oder in der Sprechstunde Fragen. So lernst du gutmöglich Sachen, die du sonst nicht gelernt hättest und findest viel leichter Interesse zum Thema. Daher ist es vor allem dann eine gute Idee, Kontakt mit Professoren zu suchen, wenn du einen Motivations-Durchhänger hast.
9. Ein Netzwerk aufbauen
Nach der Studienzeit wirst du immer wieder Zustände erleben, in denen ein grosses Netzwerk an Freunden und Bekannten aus der Universität sehr helfen kann: etwa als Übernachtungsmöglichkeit, bei der Jobsuche, als Lebensberater oder als Geschäftspartner. Nutze Facebook &Co. um auch über das Studium hinaus mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben.
10. Mindestens ein Semester im Ausland verbringen
Fast jeder Student, der für eine gewisse Zeit ein Auslandsstudium gemacht hat, wird diese Zeit zu der besten Zeit seines Lebens zählen. Du lernst eine andere Kultur kennen, machst neue Bekanntschaften und lernst vor allem über dich selbst viel. Ab zum Auslandsreferat!
11. Carpe diem – den Tag nutzen
Sei dir deiner Freiheit als Student bewusst und geniesse sie. Leiste etwas, aber hab auch Spass dabei. Die richtige Balance zu finden ist eine grosse Herausforderung, aber es ist die Mühe wert, viel darüber nachzudenken, wie du das meisterst. Denn die glücklichsten Studenten sind meist diejenigen, die genau die richtige Balance für sich gefunden haben.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Wie bewältige ich Lampenfieber vor einer Präsentation?

Wer kennt es nicht: Man steht vor einer Gruppe von gespannt lauschenden Zuschauern und auf einmal beginnt das Herz zu rasen, die Hände zittern und machen es einem schwer, die Notizen zu sehen, Schwindel verwischt die Gedanken und alles verrät dem Auditorium sofort die grosse Unsicherheit. Kein Mensch interessiert sich mehr für den Inhalt der Präsentation – alle betrachten nur noch gespannt die Ausmasse der körperlichen Stressbewältigung.
Von: Marie
Wie kann man die häufigsten Symptome vermeiden?
Herzrasen – Es hat nicht nur Auswirkungen auf euer Gemüt, sondern wirkt sich schnell auf die ganze Präsentation aus:
Ein hoher Puls während einer Präsentation erzeugt bei vielen Betroffenen „zugeschnürte“ Atemwege, stark gerötete Wangen und Schweissausbrüche. Menschen, die schnell zu beschleunigten Herzschlägen neigen, sollten daher sicher bereits einen Tag vor der Präsentation eine Art Diät einhalten. Zum Beispiel solltet ihr auf Kaffee verzichten. Koffein erhöht den Puls und den Blutdruck, verringert allerdings die Geschwindigkeit, mit der das Blut durch das Gehirn fliesst. Das kann dann dazu führen, dass euch schwindelig wird und es euch schwer fallen könnte, die gesamte Präsentation über zu stehen.
Um Schwindel zu vermeiden, solltet ihr zusätzlich ausreichend gegessen haben, auch am Abend vor der Präsentation. Ausreichend bedeutet in diesem Fall aber nicht viel, sondern nahrhaft. Und esst Bananen, um eure Standhaftigkeit zu verbessern. Sie sind reich an Kalium, was eurer Muskulatur gut tut, und der Fruchtzucker ist ein guter Energielieferant. Kalium hilft übrigens auch gegen zitternde Hände: Es stärkt die Kontraktionsfähigkeit der Muskeln.
Um nicht mitten in der Präsentation wieder Hunger zu verspüren, solltet ihr euch kurz zuvor ballaststoffreich ernähren. Esst also besser ein belegtes Vollkornbrot statt eines Schokoriegels.
Ein weiteres Problem können Schweissausbrüche sein. Sie sind leider ziemlich offensichtlich und versetzen den Präsentierenden häufig in eine Unsicherheit, die sich auf die gesamte Präsentation auswirkt.
Nicht nur Koffeinverzicht kann dem abhelfen, sondern auch die richtige Wahl der Bekleidung. Informiert euch unbedingt über das Wetter und über die Temperaturverhältnisse im Raum, in welchem ihr eure Präsentation haltet. Ist es sehr warm? Sind viele Fenster im Raum? Scheint die Sonne oder regnet es? Um die optimale Kleidung zu finden, geht morgens schnell mal vor die Tür, um die Wetterverhältnisse zu prüfen und nutzt den „Zwiebellook“. Für den Fall, dass die Temperatur im Laufe des Tages gewaltig steigen sollte, seid ihr so vorbereitet, nicht ins Schwitzen zu kommen.
Um Sodbrennen und Aufstossen vorzubeugen, vermeidet fettiges Essen, Alkohol und säurehaltige Getränke wie Orangensaft. Steigt lieber auf Wasser um, und wenn es doch zu Reflux kommen sollte oder ihr den Eindruck habt, über die Nacht könnte sich überschüssige Magensäure gebildet haben, haltet eine kleine Tüte Müsli oder Cerealien bereit, von der ihr von Zeit zu Zeit naschen könnt.
Nach einiger Zeit des Sprechens – welche Überraschung – scheint der Mund auszutrocknen. Hilfreich ist auch hier wieder eine kleine Diät: Koffein, Nikotin und Zucker sind häufig die Übeltäter. Um also nicht sofort an Speichelarmut zu leiden, solltet ihr euren Tabakkonsum vor der Präsentation einschränken, auf zucker- und koffeinhaltige Getränke verzichten und euch ein Glas stilles Wasser (Kohlensäure könnte für unangenehmes Aufstossen sorgen) für die Präsentation bereitstellen. Keiner wird etwas dagegen haben, wenn ihr ab und zu einen Schluck trinkt.
Das wohl am häufigsten auftretende Problem sind Blackouts, Gedankenabschweifungen und Schwierigkeiten, sich auf die Präsentation zu konzentrieren. Um diese Probleme vollständig zu vermeiden, sind leider nicht nur ein paar kleine Tipps notwendig, sondern auch eine Menge Übung. Eine gute und pünktliche Vorbereitung auf euer Thema ist unverzichtbar. Fangt nicht erst 3 Tage im Voraus an, eure Präsentation vorzubereiten. Am besten ist es, sich einen Lernpartner zu suchen, der weder mit dem Thema vertraut ist, noch zu unerfahren ist, um konstruktive Kritik oder Vorschläge zu geben.
Geht es immer und immer wieder durch und lasst euer Gehirn etwa einen Tag vor der Präsentation entspannen – den Vortag solltet ihr maximal zum Nachsehen oder für kleine Gedankenabgleiche nutzen.
Für die Ernährung gibt es einen Tipp: Lasst euch nicht von anderen Stressfaktoren wie den oben genannten aus der Fassung bringen. Wenn ihr diese Tipps befolgt, sollte es eurer Konzentration positiv entgegenkommen. Als „I-Tüpfelchen“ empfehlen eingefleischte Redner den altbekannten Traubenzucker. Den solltet ihr allerdings nicht verschlingen sondern in regelmässigen Abständen geniessen, damit ein etwa gleichmässiger Spiegel beibehalten wird.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
15 Tipps gegen Prüfungsangst
 |

Einige von euch werden sich regelmässig mit einem leidigen Thema beschäftigen müssen: Prüfungsangst! Wie ihr euch am besten gegen Prüfungsangst wehrt und ebendiese überwindet, sagen wir euch nun.
Und los geht’s!
Von: Marie
1. Bereitet euch gut auf die Prüfung vor! So könnt ihr Unkenntnis als mögliche Fehlerquelle ausgrenzen. Das beruhigt ungemein!
2. Macht euch klar, dass die Welt nicht untergeht, wenn ihr die Prüfung nicht besteht. Das Leben geht weiter!
3. Habt keine Angst vor Fehlern! Kleine Fehler sind nicht schlimm und gravierende Fehler werdet ihr beim Nachlesen bemerken. In mündlichen Prüfungen ist es nicht schlimm, sich zu korrigieren, denn der Prüfer weiss, dass Aufregung dazu gehört.
4. Verdrängt negative Gedanken vor der Prüfung. Nehmt euch am besten 2-3 Minuten Zeit, setzt euch an einen ruhigen Ort und denkt an etwas Schönes und Beruhigendes, während ihr tief durchatmet. Solche kleinen Entspannungsübungen schütteln Stresshormone ab.
5. Gegen Prüfungsangst hilft auch Optimismus: Seid ihr euch sicher, das Gefragte locker beantworten zu können, so entspannt ihr automatisch und die gelöste Stimmung beeinflusst eure Leistungen auch positiv.
6. Nehmt euch am Anfang einer schriftlichen Prüfung einen Moment Zeit und geht alles in Ruhe durch. So könnt ihr einen Zeitplan machen und euch nach und nach von den leichteren zu den schwierigeren Themen durcharbeiten.
7. Achtet darauf, euch nicht zu streng zu beobachten. Wenn ihr stark darauf achtet, nicht rot zu werden, nicht zu schwitzen oder zu zittern, wird es euch erst recht passieren. Also: Konzentration auf den Inhalt!
8. Motiviert euch gegen Prüfungsangst: Prüfungen sind der letzte Schritt zu einer wohlverdienten Erholungsphase! Und dazu kommt, dass ihr endlich Gelegenheit habt, alles, was ihr in euch hineingelernt habt, auch wieder loszuwerden.
9. Achtet ein wenig darauf, wie ihr euch vor der Prüfung ernährt – so könnt ihr Sodbrennen, Übelkeit und ähnliches eindämmen oder sogar verhindern, was wichtig gegen Prüfungsangst ist.
10. Macht euch klar, dass Prüfungen zum Studium gehören wie das tägliche Zubereiten von Essen: Es ist nicht immer angenehm, aber immer notwendig, und macht nur dann Spass, wenn man sichfreuen kann, sein Wissen zu verwenden.
11. Gegen Prüfungsangst bei mündlichen Prüfungen solltet ihr euch unbedingt im klaren sein, dass eben nicht der Prüfer am längeren Hebel sitzt, sondern ihr. Der Prüfer ist auch nur ein Mensch und hat Verständnis für Unsicherheiten – solange ihr vorbereitet seid!
12. Geht bei der Vorbereitung kein zu grosses Risiko ein. Bereitet euch nicht nur auf die Themen vor, von denen ihr glaubt, sie werden abgefragt. Lernt alles! Wenn ihr die Sicherheit habt, alles, was gefragt werden kann, schon einmal gesehen zu haben bzw. zu wissen, ist es das beste Mittel gegen Prüfungsangst.
13. Wenn euch ein Blackout droht, nehmt euch kurz eine Auszeit von der Prüfung und findet zu euch selbst. Kleine Entspannungsübungen und tief durchatmen helfen euch dabei.
14. Führt euch gegen Prüfungsangst vor Augen, dass ihr in eurem Leben bereits etliche Prüfungssituationen bewältigt habt – anders wärt ihr nicht so weit gekommen!
15. Eure Kommilitonen werden sicher auch Mittel gegen Prüfungsangst suchen. Besprecht euch mit ihnen in einer lockeren Runde. Es kann erlösend wirken, unter Gleichgesinnten zu sein.
Sicher ist es schwer, sich nach allen Tipps zu richten. Aber dass ihr euch die Zeit nehmt und Tipps gegen Prüfungsangst sucht, darf euch ruhig stolz machen. Sich nicht hinter seinen Ängsten zu verstecken, ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Prüfung!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
GRE-Test - 10 Fragen und Antworten
Wer mit dem Gedanken spielt, im englischsprachigen Ausland zu studieren, wird früher oder später etwas über den GRE-Test lesen, der in diesen Ländern von den meisten Universitäten verlangt wird. Zuverlässige Informationen über den Test sind aber oft schwer zu bekommen. Study4Success hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Von: S4S-Team
Was ist der GRE-Test?
Das ist ein standardisierter Test, der zur Aufnahme an amerikanischen und auch an vielen anderen ausländischen Universitäten verlangt wird. Er testet die analytischen und mathematisch-logischen Fähigkeiten und das Sprachgefühl der Bewerber. Die Universitäten wollen durch den GRE Test aber auch erfahren, wie fleissig und motiviert ein Student ist, denn einen guten “Score” kann man nicht nur durch Intelligenz, sondern auch durch eine optimale Vorbereitung erreichen.
Wer muss den GRE-Test machen?
(Fast) alle Bewerber für amerikanische Graduiertenstudiengänge (Master und Doktor) müssen den GRE-Test absolvieren und ihre Punkte einreichen. Auch in anderen englischsprachigen Ländern wird der Test für bestimmte Studiengänge (vor allem in technisch-mathematischen Fächern) verlangt.
Wie ist der GRE-Test aufgebaut?
Der Test wird an einem Computer in einem kameraüberwachten Testzentrum gemacht. Spicken ist also unmöglich.
Der GRE General Test besteht aus den folgenden Teilen:
Analytical writing - 2 Essays, (1x Stellungnahme zu einem bestimmten Thema und 1x Analyse eines bestimmten Sachverhaltes (75 Minuten, Punktzahl von 0-6).
Verbal reasoning - sprachliche Fähigkeiten (30 Fragen, 30 Minuten, Punktzahl 200-800)
Quantitative reasoning - mathematisch-logisches Denken (28 Fragen, 45 Minuten, Bewertungsskala 200-800)
Es gibt neben dem GRE General Test auch den GRE Subject Test, der oft von Bewerbern der Fächer Biochemie, Zell- und Molekularbiologie, Biologie, Chemie, Informatik, Englische Literatur, Mathematik, Physik und Psychologie verlangt wird. Der Subject Test besteht aus etwa 70 bis 100 Fragen und dauert 170 Minuten.
Welche Punktzahl gilt als “gut”?
In der folgenden Tabelle siehst du die Score-Verteilung für die einzelnen Sektionen:
Welche Punktzahl sollte man erreichen, um an einer Top-Uni angenommen zu werden?
Grundsätzlich gilt, dass der GRE Score nur ein Kriterium von mehreren ist, nach dem Universitäten sich ihre Studenten aussuchen. Es ist aber aus Erfahrung bekannt, dass es wohl das wichtigste Kriterium ist, gefolgt von Empfehlungsschreiben, dem Bewerbungsschreiben (“Statement of Purpose”) und zuletzt dem Notendurchschnitt.
Die Top 20 Universitäten in den USA erwarten, dass man in mindestens einer Sektion unter den ersten 10% der Bewerber ist, je nach dem, welche Sektion für das Fach wichtiger ist. Das wird zum Beispiel bei VWL-Studenten der quantitative Teil sein, der verbale Teil sollte aber auch bei ihnen schon weit überdurchschnittlich sein, vielleicht so um die 80% Marke herum wäre in Ordnung. In Fächern wie Geschichte oder Philosophie wird mehr auf den verbalen Teil geschaut als auf den quantitativen Teil.
Die meisten Universitäten verlangen von ausländischen Universitäten nicht so hohe Scores wie von amerikanischen Bewerbern. Die analytische Sektion gilt als die unbedeutendste und wird oft nur beiläufig erwähnt, wahrscheinlich weil die Texte von einem Panel gelesen und bewertet werden und somit als weniger standardisiert gelten als die anderen Sektionen.
Da zum Beispiel Ingenieure oft andere Begabungen haben als Literaturwissenschaftler, muss man die Scores immer fachbezogen einordnen. In der folgenden Tabelle siehst du, wie Studenten verschiedener Fachrichtungen in den einzelnen Sektionen abschneiden. So kannst du auch ungefähr einschätzen, welcher Score in deinem Fach erwartet wird:
Wo kann ich den GRE-Test machen?
Der Test wird in Frankfurt, München und Berlin angeboten.
Wo kann ich mich anmelden?
Du kannst dich unter www.gre.org anmelden.
Wieviel kostet die Teilnahme am GRE-Test?
Die Testgebühr beträgt 180 US-Dollar. Der Test kann bis 3 Tage vor dem geplanten Termin gegen eine Gebühr von 50 US-Dollar verschoben werden.
Wie oft kann der GRE-Test wiederholt werden?
Der GRE-Test kann maximal bis zu 5 Mal im Jahr wiederholt werden, wobei es pro Monat maximal nur einmal möglich ist.
Wie bereite ich mich am besten auf den GRE-Test vor?
Das verraten wir dir bald in einem speziellen Artikel dazu! In der Zwischenzeit empfehlen wir das folgende Buch, das sich aus eigener Erfahrung als das beste GRE-Vorbereitungsbuch herausgestellt hat.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
10 Tipps, das Lernen im Studium nicht länger aufzuschieben

Man kennt es oft selbst, Dinge, die man nicht gerne tut, werden gerne aufgeschoben, egal ob es Entscheidungen sind, deren Ausmass man nicht überblicken kann oder Dinge, für die man jetzt seine Zeit und Energie konzentriert aufwenden muss, wie wirkungsvolles Lernen. Manchmal hilft sogar kurzzeitig das Aufschieben, solange nicht das eigene Vorankommen davon abhängt, aber irgendwann ist die Zeit vor den Prüfungen da, die ein Aufschieben ohne Konsequenzen nicht mehr erlaubt und das Studium in Gefahr bringen.
Von: Sebastian
Gerade in einer solchen Phase kann man nicht motiviert ans Lernen gehen, etwas, was nur mit einem selbst zu tun hat und auch eine positive Rückmeldung erfahren soll. Denn vielen ist nicht klar, dass das Aufschieben viel mehr an Aufwand und Energie verbraucht und zudem am Selbstwertgefühl nagt. Das Fazit ist, dass man aus diesem Tief erneut Kräfte sammeln muss, um fleissig zu lernen, was in der Folge um so schwerer fällt.
Es gibt aber immer auch gute Gründe, das Lernen nicht aufzuschieben, einige von diesen Gründen sollen dir helfen, das Lernen als Motivator zu sehen, und es nicht wieder aufzuschieben.
1. Aufgaben werden in einer durchführbaren Zeit erledigt, dabei geht es nicht darum, am Tag viel zu lernen, sondern das Lernen durch die Vorgabe einer Zeit wirkungsvoll vorzunehmen, auch den Zeitpunkt des Lernens zu bestimmen, um dann bewusst an einem bestimmten Punkt zu enden (wenn der Termin einer Klausur oder Prüfung bekannt ist, das Lernen so zu gestalten, dass man in kleinen Schritten lernt, d.h. am Tag 5 Seiten zu lesen und diese zu überdenken und den Rest des Tages anderen Aufgaben widmet, so nimmt der Druck ab und man bekommt ein Gefühl dafür, ob man die Menge erhöhen möchte) - das Lernen erhält dadurch eine ganz andere Relevanz, aber keinesfalls eine schlechtere, eher eine bessere.
2. Selbstbestimmung durch gutes Zeitmanagement (Hobbies können viel entspannter ausgeübt werden, es wirkt sich insgesamt besser auf die geistliche Verfassung aus), durch zeitbestimmtes Lernen sich selbst belohnen, dabei sollte die Belohnung so interessant sein, dass sie als Motivator wirkt - es hilft dir vielleicht auch, visuell den Lernstoff für den Tag zu notieren mit der dazu gehörigen Belohnung.
3. Steigerung des Selbstwertgefühls, was mit deiner Selbstbeobachtung beginnt und mit der jetzt anders genutzten Zeit und Arbeitsweise folgt. Tipp: Durch eine Selbstanalyse mittels eines Tagebuchs kannst du den Gründen des Aufschiebens näher kommen und auch die damit verbundenen Gefühle sowie dein Verhalten darauf beobachten.
4. Aufgaben und das Lernen nicht als Strafe zu betrachten, sondern als kleiner Schritt auf das eigentliche Ziel - Lernen als selbstbestimmten Weg
5. Eingeständnis des Aufschiebens - Erkenne das Problem an, dass du ständig das Lernen aufschiebst. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.
6. Es wird empfohlen, Gruppen aufzusuchen, um gemeinsam zu lernen und an gleichen Zielen zu arbeiten, denn es geht vielen oft ähnlich wie dir. In der Gruppe könnt ihr euch gegenseitig zwingen das Lernen nicht weiter aufzuschieben. Eventuell reicht es auch aus zu sehen, wie andere die Sachen einfach anpacken - dies setzt dich selbst unter Druck und verhindert weiteres Aufschieben.
7. Effektives Lernen und gezielter Ausgleich können auch dazu führen, schneller als erwartet mit dem Lernstoff fertig zu werden. Wenn das Lernen als etwas empfunden wird, was man für sich selbst macht, kann es als positiv wahrgenommen werden. Dies setzt allerdings eine emotionale Selbstkonfrontation voraus, doch danach scheint das Aufschieben nicht mehr notwendig
8. Erstellung von Wochen- bzw. Arbeitsplänen, die genau dokumentieren, was wieviel gemacht wird, bieten einen guten Leitfaden - eine strategische Zuweisung von Aufmerksamkeit
9. Mit dem Lernen genau dann aufzuhören, wenn man es sich vorgenommen hat, auch wenn es besonders gut läuft, kann ebenfalls helfen Aufschieben dauerhaft zu vermeiden. Das Gehirn merkt sich diese Erlebnisse und speichert sie wesentlich leichter ab, wenn man nicht völlig verausgabt mit dem Lernen aufhört. Somit gelingt die Erinnerung an den verarbeiteten Stoff schneller, so dass man später mit mehr Motivation wieder ans Lernen geht. Zudem schafft man eine positive Verbindung zum Lernen und verkleinert dadurch den Widerstand zu lernen.
10. Durch das Schaffen von Zeitfenstern wird die Arbeit bedeutend überschaubarer, man kann besser einschätzen, was man geleistet hat und spürt den Erfolg stärker.
Es ist äusserst hilfreich, wenn es einem die Zeit erlaubt, selbst die Rahmen fürs Lernen festzulegen. Hält man sich an seinen selbst vorgegebenen Lernplan, schafft man Belohnungen statt Ablenkungen. Statt sich für die Ablenkungen und das Aufschieben schuldig zu fühlen, empfindet man seine freie Zeit deutlich positiver und schafft zusätzliche Motivation.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
10 Tipps für mündliche Prüfungen

Jeder kennt den kalten Schweiss, der einem auf der Stirn und unter den Achseln steht, den Frosch im Hals schon bei der Begrüssung und die panische Angst des Versagens bei der mündlichen Prüfung. Doch warum ist das so und wie kann man das vermeiden?
Hier erhaltet ihr 10 äusserst nützliche Tipps, um die mündliche Prüfung ohne solch nicht gerade förderlichen Panikreaktionen zu bestehen.
Von: Marie
1. Bereite dich selbst natürlich gut und rechtzeitig auf die Prüfung an einem ruhigen und ungestörten Ort vor und werde dir dessen auch bewusst.
2. Betrachte die Angstreaktionen als positives Zeichen der Vorbereitung auf die anstehende Höchstleistung und konzentriere dich in der mündlichen Prüfung nicht auf deinen Körper, sondern auf die Fragen, die dir gestellt werden
3. Du kannst durch die Einnahme von homöopathischen Mitteln - Bsp. Kohletabletten gegen Durchfall - einige Symptome lindern, sie sollten dich aber nicht geistig beeinflussen.
4. Sage dir selbst immer wieder, dass du dich gut vorbereitet hast! So was nennt man positive Affirmationen, hört sich an wie eine Phrase, hilft aber wirklich.
5. Vermeide die Denkansätze wie "Was, wenn ich die Prüfung nicht bestehe?", denn jedes Katastrophendenken ist negativ und hilft auch nicht wirklich weiter.
6. Kurz vor der mündlichen Prüfung sollte nichts mehr gelernt werden, weil dadurch nur die Angst und die Aufregung bekräftigt wird und die Ausschüttung von Stresshormonen, die den Abruf des gelernten Wissens aus dem Langzeitgedächtnis blockieren können.
7. Konzentriere dich während der mündlichen Prüfung auf deine Atmung, diese kann bei Angst und Stress sehr schnell und flach werden. Ein langes ruhiges Ausatmen wirkt entspannend. Atme etwa 2-3mal so lange aus wie ein und presse die Luft dabei durch deinen verengten Mund, das wird auch bei Atemnot empfohlen.
8. Die Rollenspiele und Übungen in Lerngruppen oder in professionellen Vorbereitungskursen sind ebenfalls eine gute Hilfe als Vorbereitung zur mündlichen Prüfung.
9. Man sollte sich etwas Angenehmes für die Zeit nach der Prüfung vornehmen, um sich für die Mühen zu belohnen, vielleicht einen Urlaub oder einen Besuch bei Freunden oder Bekannten. Hiermit zeigen wir auf, dass die mündliche Prüfung nicht das Ende aller Dinge ist, egal wie es ausgeht.
10. Sollte alles nicht helfen und man schon lang vor der Prüfung merkt, dass die vorherigen Punkte nicht ausreichen, kann man an der FH oder Universität eine psychologische Beratungsstelle aufsuchen und dort kompetente Unterstützung suchen.
Kurz oder lang, das Fazit ist: „don`t panic!“ Es bringt nichts, sich verrückt zu machen und die Nerven zu verlieren, das kostet nur wichtige Zeit. Es gab schon abertausende vor uns, die durch die mündliche Prüfung mussten und es geschafft haben. Befolgt die Ratschläge und ihr werdet sehen, es ist zu schaffen, auch wenn es schwer ist.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Ziele definieren und erreichen!

Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn du alles schaffen würdest, was du dir vorgenommen hast, wenn du jede Prüfung bestehen und alle deine Ziele erreichen würdest?
Viele Menschen tun dies tagtäglich und denken auch ständig daran, wie dies am schnellsten realisiert werden kann.
Wenn auch du es schaffen willst, zweifle nicht eine Sekunde an dir! Denke immer positiv und verliere deine Ziele nie aus den Augen! Nimm auch die nachfolgenden Anregungen als Hilfe für deine Zielsetzung:
Von: Max
1. Lege deine Ziele fest:
1. Frage dich zuerst, um was es dir eigentlich geht, was du erreichen willst und schreibe deine Ergebnisse auf. Überlege nicht zu lange, Spontanität ist hier gefragt. Was es dir bringt? - Du kannst jeden Tag sehen, auf was es dir im Leben ankommt, worauf du hinarbeitest, was das Wichtigste ist.
2. Schreibe deine Ziele am besten täglich auf, um einen besseren Überblick über das Heute zu haben, denn deine Zielsetzungen können sich mit der Zeit verändern.
3. Setze dir grössere Ziele, du kannst sie deinen alltäglichen Lebensumständen anpassen und umformulieren oder verbessern. Manage dich selbst.
4. Denke an soziale Komponenten, setze Prioritäten:
a. Geld und Job - hier siehst du, WAS du erreichen willst
b. Familie und Gesundheit - WARUM du dein Ziel erreichen möchtest
c. Fort- und Weiterbildung, Wissensdurst - WIE du deine Ziele erreichen kannst
5. Jetzt überlege dir dein allergrösstes Ziel (die Nr. 1). Frage dich z. B.:
Was würde ich tun, nicht mehr tun oder anders machen, wenn ich einen riesigen Geldbetrag gewinnen würde?
2. Ziele verbessern
1. Du willst deine Ziele vervollständigen? Dann halte die Ziele, die du in den nächsten 5 Jahren erreichen willst schriftlich fest, unwichtig ob realisierbar oder nicht.
2. Deine Ziele sollten nun in 3 Teilziele (1-3) gegliedert werden
- welches Ziel dir am wichtigsten ist
- welches auch wichtig ist, aber nicht so wichtig, wie das Ziel 1
- welches Ziel nicht unbedingt erreicht werden muss.
3. Schreibe zum Abschluss zu jedem Ziel auf, mit welchen Mitteln du es erreichen willst.
Fazit:
Durch effiziente und tägliche Planung, die nur wirklich wenige Menschen in dieser Form praktizieren - und nur diese haben wirklichen Erfolg, weil sie so ihre Ziele erreicht haben - wirst auch du es schaffen!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erweiterung der Wahrnehmungsspanne
 |

Wenn du dich auf einen Punkt mitten auf deinem Computerbildschirm konzentrierst, nimmst du immer noch die Ränder des Bildschirms wahr. Bei der Wahrnehmung der Bereiche um den Fixierungspunkt herum spricht man von peripherem Sehen.
Training des peripheren Sehens kann deine Lesegeschwindigkeit vervielfachen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Wenn du die in der unterstrichenen Zeile oben im Text das Wort „von“ liest (mit der Fixation auf „von“) nimmst du ebenfalls die Wörter „man“ und „peripherem“ wahr. Bei gutem peripheren Sehen nimmst du ebenfalls die Wörter „spricht“ und „Sehen“ wahr.
Von: Sebastian
Das Ziel ist es, diese Sichtweite zu vergrössern und wirkungsvoller einzusetzen. Denn ineffizienterweise geht ein guter Teil deiner peripheren Sicht ins Nichts, wenn du in der markierten Zeile die Wörter am Rand, „den“ und „peripherem“ liest (wenn du dich auf diese konzentrierst). So kann es sein, dass du durch ineffizentes Nutzen deiner peripheren Sicht 25-50% deiner Lesezeit auf leere Ränder vergeudest.
1. Technik (1 Minute)
Führe einen Stift mit gleichmässiger Geschwindigkeit unter dem Text her. Die Geschwindigkeit sollte wieder bei einer Sekunde pro Zeile sein. Diesmal setzt du jedoch beim 2.Wort in der Zeile an und hörst beim Vorletzten auf. Wie bei den Übungen zuvor: Mach dir keine Sorgen um Inhaltsverständnis! Scanne nicht langsamer als eine Sekunde pro Zeile, versuche sogar die Geschwindigkeit mit Verlauf der Übung zu erhöhen. Mach die Übung auf keinen Fall langsamer!
2. Technik (1 Minute)
Führe einen Stift wieder mit gleichmässiger Geschwindigkeit unter dem Text her, die Geschwindigkeit wieder bei einer Sekunde pro Zeile. Diesmal setzt du jedoch beim 3.Wort in der Zeile an und endest beim vorvorletzten Wort.
3. Geschwindigkeit (3 Minuten)
Setze das Lesen beim 3.Wort an und scanne bis zum vorvorletzten Wort, wie bei der 2.Technikübung. Wiederhole die Übung, diesmal nur mit einer halben Sekunde pro Zeile!Wie zuvor ist es völlig normal, wenn du wenig bis nichts verstehst und wie zuvor ist Inhaltsverständnis nicht Ziel der Übung. Ziel ist es, deine eingefahrenen Wahrnehmungsangewohnheiten zu ändern. Daran muss sich dein visuelles System erst einmal gewöhnen. Wenn du die Übungsanwendung regelmässig durchziehst (auch wenn du dabei nichts verstehst), wirst du dennoch Veränderungen in deinem Leseverhalten nach der Übung feststellen. Führe die Übung also konzentriert 3 Minuten aus, versuche wieder überwiegend die Geschwindigkeit zu pushen. Drifte nicht in Gedanken ab, sondern konzentriere dich, dem Fixierungspunkt über der Stiftkappe zu folgen.
Ergebniskontrolle
Als letzten Schritt solltest du jetzt deine Fortschritte testen. Benutze die beiden Techniken wie du sie zuvor geübt hast (Fixationskontrolle und peripheres Sehen). Lies diesmal nur so schnell, dass du den Inhalt verstehst. Konzentriere dich aber darauf, das Gelernte anzuwenden (vor allem: Tracker folgen um Fixationen zu reduzieren, kein zurückspringen, stetiges Tempo, peripheres Sehen).Ermittle nach einer Minute deine WpM wie anfangs erklärt. Wenn du die Übungen befolgst und die Techniken angewandt hast, steigerst du dich bereits nach der ersten Anwendung. Wenn du jeden Tag übst, wirst du mittel bis langfristig dreistellige Steigerungen wahrnehmen.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Guter Schlaf = gutes Gedächtnis = gute Noten
 |

Sigmund Freud wusste es schon: Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiches Lernen und Erinnern. Freud vermutete, dass das Gehirn während des Schlafes den Tag revue passieren lässt und dabei die Informationen ins Gehirn einprägt. In zahlreichen Studien konnte die moderne Wissenschaft nachweisen, dass guter Schlaf tatsächlich einen gedächtnisfördernden Effekt hat. Seit kurzem versteht man auch die genauen Prozesse, die dahinter stecken (siehe Nature Neuroscience Journal, September 2009).
Wie kann man also in einer wichtigen Lernphase für idealen Schlaf sorgen? Wir bei BrainEffect verraten es dir:
Von: BrainEffect-Team, 04. Mai 2010
Mach deine Schlafzeiten zur Gewohnheit:
Gehe jeden Abend zur selben Uhrzeit schlafen und stehe jeden Morgen zur selben Uhrzeit auf. Sehr bald gewöhnt sich dein Körper daran und du wirst morgens ganz natürlich wach, ohne geweckt werden zu müssen.
Betätige dich körperlich:
Du solltest mindestens einmal täglich etwas körperlich anstrengendes tun. Der Schlaf ist zur Erholung des Körpers da, aber wenn es nichts gibt, wovon er sich erholen muss, bleibt er wach und du wälzt dich nachts noch stundenlang hin und her. 30 Minuten Yoga, Joggen oder Schwimmen sind ideal, aber nicht unmittelbar vor dem zu-Bett-gehen.
Sorge für absolute Dunkelheit im Schlafzimmer:
Blinkende Lichter vom Laptop oder Wecker sollten abgedeckt werden.
Minimiere Elektrosmog:
Entweder du entfernst elektrische Geräte aus deinem Zimmer oder du ziehst den Stecker raus, was ein wenig hilft. Elektrosmog wird als Ursache für Schlafstörungen häufig unterschätzt, kann aber eine grosse Rolle spielen.
Befreie deinen Kopf:
Einer der Hauptgründe für Einschlafschwierigkeiten sind Gedanken und Sorgen, die einen noch im Bett beschäftigen.
Hier hast du 3 Möglichkeiten:
- du löst das Problem bzw. denkst die Sache vor dem Schlafengehen zuende (nicht im Bett, sondern in aller Ruhe, ohne TV, auf dem Sofa)
- du redest dir das Problem von der Seele
- du lernst Meditationstechniken
Spiele ruhige Hintergrundmusik:
Am besten funktioniert spezielle Einschlafmusik, die mit hypnotisierenden, weichen Klängen geradezu deine Hand nimmt und dich in den Schlaf zieht.
Achte darauf, was du vor dem zu-Bett-gehen isst und trinkst:
Du solltest weder mit leerem noch mit vollem Magen ins Bett gehen. Es sollten schon 2-3 Stunden zwischen der letzten Mahlzeit und dem zu-Bett-gehen verstreichen. Vermeide, in den Stunden vor dem Schlafen-gehen, Cola, Kaffee, Tee, Alkohol oder Tabakprodukte zu dir zu nehmen. Sorge dafür, dass du täglich mindestens 2 Liter Wasser trinkst, trinke aber eine Stunde vor dem Schlafen nichts mehr, um nächtliche Toilettengänge zu vermeiden. Falls es passiert, dass du vor Hunger nicht einschlafen kannst, versuche dich an tryptophanhaltige Nahrungsmitel zu halten, etwa Milchprodukte (z.B. Joghurt), Putenfleisch, Thunfisch oder Erdnüsse, denn sie helfen den Serotoninspiegel zu steigern, was anschliessend entspannend wirkt.
Schlafe 7-9 Stunden pro Nacht:
Nicht weniger aber auch nicht mehr, denn zuviel Schlaf erschlafft deine Muskeln, was sich im Verlauf des Tages in Form von Trägheit, Müdigkeit oder Abgeschlagenheit äussert.
Schlafe in bequemen Positionen:
Liege nicht auf dem Bauch. Wenn du seitlich liegen möchtest, klemm dir ein Kissen zwischen deine Beine um deine Hüfte zu stützen. Wenn du auf dem Rücken liegen möchtest, leg ein Kissen unter deine Beine um etwas Druck von deinem Rücken zu nehmen.
Nimm ein heisses Bad:
Mit duftendem Badeöl oder Badesalz erlebst du Entspannung pur. Aber pass auf, dass du nicht schon im Bad einschläfst! ;)
Gestalte dein Schlafzimmer mit kühlen Farben:
Warme Farbtöne regen eher an. Auch wenn das Licht aus ist, du weisst wo du dich befindest und unterbewusst fühlt man sich nunmal in einer blau-grünen oder weißen Umgebung entspannter als in einer gelb-roten.
Reguliere die Zimmertemperatur und Luftfeuchtigkeit:
Die optimale Temperatur zum einschlafen liegt bei 16 bis 18 Grad, die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei 50-60% liegen.
Räume dein Zimmer auf:
Falls du nicht schlafen kannst und dein Zimmer aussieht wie eine Kriegszone, dann nutze die Gelegenheit, mal richtig aufzuräumen. Das hilft aus mehreren Gründen: Es bringt dich auf andere Gedanken bzw. du schaltest ab, es macht dich müde und deine Schlafumgebung wird dadurch angenehmer.
Du siehst: man kann schlafen lernen! Wenn du dich nach diesen Ratschlägen während einer wichtigen Prüfungsphase richtest, wirst du einen fantastischen, erholsamen und tiefen Schlaf geniessen. Somit gibst du deinem Gehirn die Chance, das Gelernte zu festigen und schaffst ideale Voraussetzungen für höchste Konzentration am Folgetag beim Lernen oder bei den Prüfungen selbst!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Wirkungsvoll Vokabeln lernen

Die meisten haben ihre eigene Methode – manche scheitern schon daran, überhaupt eine Methode zu finden. Wovon ich spreche? Vom Vokabeln lernen! Falls du mit deiner Methode nicht zufrieden bist oder zu denjenigen gehörst, die einfach keinen wirksamen Weg finden, stelle ich in diesem Beitrag eine Methode vor, wie du wirkungsvoll Vokabeln lernen kannst.
Von: Marie
Zuerst einmal ist es für alle Lernenden wichtig, sich die Vokabeln auf kleine Karteikarten zu schreiben. Ob du die Nomen mit oder ohne Artikel lernen möchtest bleibt dir überlassen. Um gleich beim Aufschreiben mit dem Lernen zu beginnen, lies die Wörter laut vor. Und um das Vokabeln lernen gleich von Anfang an zu verstärken, schreib dir die Lautschrift (oder eine eigene Form der Lautschrift) dazu und lies diese gleichfalls laut vor. Auf die Rückseite der Karteikarte schreibst du – oh Wunder! – die deutsche Übersetzung. Wenn du das erledigt hast, kann das eigentliche Lernen losgehen. Aber die Frage ist: wie?
Da dir in den meisten Fällen nur eine gewisse Anzahl Tage für das Vokabeln lernen bleibt, teile dir die Karteikarten ganz im Sinne der Mathematik auf die einzelnen Tage auf. Für 30 Vokabeln in vier Tagen lernst du z.B. am 1. und am 2.Tag jeweils 9 Vokabeln und an den anderen beiden Tagen 7. Nimm dir für das tägliche Vokabeln lernen mindestens eine Stunde Zeit. Das mag anfangs nach sehr viel erscheinen, du wirst aber merken, dass du diese Zeit brauchst, um dir die Vokabeln gut zu merken.
Um genauer auf die Lernmethode einzugehen, gehen wir von 8 Vokabeln aus, die du zu lernen hast. Nimm dir pro Vokabel zuerst einmal eine Minute Zeit. Lies die Vokabel laut vor, bau sie (ebenfalls laut) in einen kurzen, einfachen Satz ein. Z.B. englisch „grinding - mahlen“: „the miller is grinding flour“. Daraufhin übersetzt du den Satz ins Deutsche: „der Müller mahlt Mehl“. Wenn du das einige Male laut wiederholt hast, stelle den Satz um. Z.B. „flour is ground by the miller“ – „Mehl wird vom Müller gemahlen“.
Nachdem du dies mit allen 8 Karteikarten getan hast, mische sie und leg sie mit der deutschen Übersetzung nach unten in eine Reihe. Nimm dir ein A4 Blatt, einen Stift und 3 verschiedene Marker oder Buntstifte, um Nomen, Verben und Adjektive zu unterscheiden. Lege fest, welche Farbe für was genau stehen soll und mal dir kleine Kreise, Sterne, Striche oder was auch immer dir gefällt in den verschiedenen Farben auf das A4 Blatt. Dies sollte dann aussehen wie die Überschrift einer Tabelle. Versuche möglichst darauf zu verzichten, die Überschrift 'Nomen', 'Verben' oder 'Adjektive' zu nennen, denn zu viele Buchstaben – so albern es klingen mag – lenken vom Lernen ab.
Jetzt schreibst du die Vokabeln in deine nun erstellte Tabelle. Sind unter ihnen Vokabeln, die nicht in Verben, Nomen oder Adjektive zu einzuordnen sind, schreib sie in eine Extraspalte, die du nicht benennen musst. In diese Spalte gehören dann z.B. Präpositionen und ähnliches. Lass unter jedem Wort genug Platz für die deutsche Übersetzung. Beim Vokabeln lernen ist es wichtig, immer ordentlich und gerade zu schreiben. Wenn du dich verschreibst, streich es nicht durch sondern lösche es und schreib es neu. Gehe deine Tabelle in Ruhe durch, ob auch alles an der richtigen Stelle steht.
Bist du sicher, alles korrekt eingetragen zu haben, kannst du nun mit dem schwierigen Teil beginnen: dem Übersetzen. Lies dir die Vokabel in deiner Tabelle laut vor und erinnere dich an die Übersetzung. Wenn dir die richtige Übersetzung einfällt, schreib sie unter die Vokabel in deine Tabelle. Besteht dabei noch Unsicherheit, drehe die Karteikarte um, bevor du das deutsche Wort aufschreibst. Sonst prüfst du die Richtigkeit deiner Übersetzung nach dem Aufschreiben. Diese kleine Übung gehst du nun mit allen 8 Vokabeln durch.
So kommst du auch schon zum letzten Schritt: dem Benutzen der Vokabeln. Nimm dir ein neues Blatt und schreib dir die Vokabeln und ihre Übersetzung untereinander auf. Jeweils rechts von ihnen schreibst du nun einen Satz, in dem du die Vokabeln verwendest. Beispiel:
Grinding – The miller is grinding flour.
Mahlen – Der Müller mahlt Mehl.
Dabei liest du immer laut mit.
Die Vokabeln, die dir Schwierigkeiten bereitet haben, kreuzt du in deiner Tabelle an und legst die passenden Karteikarten auf einen separaten Stapel. Nach einer kleinen Pause wiederholst du die ganze Übung dann mit diesen Vokabeln – so lange bis du den Stapel abgearbeitet hast. Am Schluss gehst du alle Karteikarten noch einmal in der Hand durch und legst sie beiseite. Nun kannst du etwas Kraft schöpfen und am nächsten Tag hoch motiviert die nächsten Vokabeln lernen.
Auch wenn dir diese Methode Vokabeln zu lernen sehr aufwendig erscheinen mag, sie ist wirkungsvoll. Nach kürzester Zeit wirst du so eingefleischt sein, dass du leichter Vokabeln lernen wirst als alles andere. Diese Routine veranlasst dein Gehirn sogar, sich an Gelerntes zu erinnern, sodass du sicher sein kannst, dass du die Vokabeln abrufen kannst, wenn sie gebraucht werden.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Mit Psycho-Tricks geht das Auswendig-Lernen leichter!

Unser Gehirn macht seltsame Dinge. Es verwechselt Sachen, merkt sich nur Teile von Informationen, blockiert den Zugriff auf gespeichertes Wissen, oder vergisst es schlichtweg. Dagegen gibt es scheinbar nur ein Mittel: Auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen!
Das Problem: Auswendig lernen ist langweilig. Aber zum Glück können wir manche seltsamen Eigenheiten des Gehirns zu unserem Vorteil nutzen!
Von: BrainEffect-Team, 04. Mai 2010
Der Kontext-Effekt:
Informationen, die im selben Kontext abgerufen werden wie sie gespeichert wurden, werden leichter vom Gehirn abgerufen. Informationen, die also bei einer Vorlesung gespeichert wurden, können leichter wieder abgerufen werden, wenn die Umgebung ähnlich ist (etwa wenn die Klausur im selben Vorlesungssaal oder Universitätsgebäude geschrieben wird). Auch andere Stimulatoren, etwa das Wetter, Geruch, Geschmack oder gar Melodie können als Aufhänger benutzt werden um erlernte Informationen leichter wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Tipp: Das Lernen am Prüfungsort ist eine effektive Methode auswendig gelerntes in Erinnerung zu behalten. Falls dies aus anderen Gründen für dich nicht in Frage kommt, nutze andere Wege, Assoziationen mit dem gelernten Material zu schaffen. Esse oder trinke etwas beim Lernen, was du dann später mit in die Klausur nehmen kannst. Diese Methode hört sich seltsam an, doch die Wissenschaft hat diesen Effekt klar nachweisen können.
Der Humor-Effekt:
An Informationen, die mit Humor vermittelt wurden, kann man sich leichter wieder erinnern. Wissenschaftler erklären sich dies mit erhöhter kognitiver (Humor muss verstanden und verarbeitet werden) und emotionaler (Humor erregt) Aufmerksamkeit beim Zuhörer.
Tipp: Versuche über die Sachen, die du auswendig lernen musst aber einfach nicht in den Kopf kriegst, zu lachen. Lass dir von einem Freund (am besten von einem peinlich-durchgeknallten Freund) das vorlesen, was du auswendig lernen musst, und lass sie oder ihn an besonders schwierigen Stellen komische Nebenbemerkungen machen oder Grimassen ziehen. Beim Auswendiglernen von Texten kann man auch selbst einzelne Satzteile so verändern, dass die Textstelle komisch wirkt. Wenn du dich an einer Stelle einmal zum Lachen gebracht hast, wirst du dich später sehr gut an sie erinnern können.
Selbstbezugs-Effekt:
Wenn Informationen einen Bezug zu unserem eigenen Leben haben, erinnern wir uns viel leichter an sie.
Tipp: Informationen, die abstrakt sind, sollten präzisiert werden und auf die reale, selbst erlebte Welt angewandt werden. Dazu formuliert man das Konzept um oder macht daraus ein Beispiel, das persönliche Emotionen, Assoziationen oder Interesse weckt. Das ist für Literatur-Studenten leichter als für Studenten der theoretischen Physik, aber es ist alles eine Frage der Kreativität.
Der Anfang-und-Ende-Effekt:
Die ersten und letzten Punkte einer Liste kann man sich leichter merken, als die in der Mitte.
Tipp: Setze die Punkte, die dir am schwersten fallen beim Auswendiglernen einer Liste an den Anfang oder ans Ende. Im mittleren Teil sollten besonders Punkte sein, die du dir schon gut gemerkt hast oder die dir leicht fallen. Falls du immer noch Schwierigkeiten damit hast, dir die letzten Punkte der Liste zu merken, nutze den Modalitäts-Effekt.
Der Modalitäts-Effekt:
Informationen am Ende einer Liste sind leichter einzuprägen wenn sie mündlich vorgetragen worden sind.
Tipp: Wenn du vor allem beim unteren Teil einer Liste Schwierigkeiten mit dem Auswendiglernen kriegst, lass dir alle Wörter bzw. den ganzen Text laut vorlesen. Dein Gehirn wird sich automatisch besonders den letzten Teil gut merken.
Der Von-Restorff-Effekt:
Begriffe, die herausstechen, werden leichter gemerkt als andere. Dieses spontan einleuchtende Phänomen wurde erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts von der Psychologin Hedwig von Restorff wissenschaftlich belegt.
Tipp: Begriffe, die du dir nur schwer einprägen kannst und/oder die besonders wichtig sind, solltest du unterstreichen, farbig markieren oder in fetter Schrift schreiben.
Der Zeigarnik-Effekt:
Eine Studie der russischen Psychologin Zeigarnik ergab, dass Studenten, die ihre Lerneinheiten unterbrachen um Dinge zu tun, die nicht mit dem Lernmaterial zusammenhängen (z.B. Sport treiben oder etwas anderes lernen), das Gelernte besser behalten als Studenten, die ohne eine solche Pause lernen.
Tipp: Achte darauf, dass du nicht zu lange am Stück lernst. Plane Pausen ein, die du mit Aktivitäten füllst, die möglichst nichts mit deinem Lernmaterial zu tun haben.
Der Zeitraum-Effekt:
Informationen werden besser im Gehirn gespeichert, wenn sie über einen längeren Zeitraum vermittelt werden. Es bringt also mehr, eine Vokabelliste über einen Zeitraum von zwei Wochen fünf mal durchzupauken, als es an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zu tun.
Tipp: Verteile deine Lerneinheiten über einen längeren Zeitraum und du wirst dir den Stoff besser merken können.
Der Test-Effekt:
Wenn auswendig gelerntes Material häufig getestet wird, prägt es sich besser ein. Das bedeutet, dass es effektiver sein kann, fünf mal einen Text zu lesen und den Inhalt nach jedem Mal abfragen zu lassen, als ihn zehn Mal zu lesen ohne den Lerneffekt zu testen.
Tipp: Lerne zu zweit oder in der Gruppe. Fragt Euch abwechselnd den Stoff ab. Dabei kannst du Zeit und Energie sparen, wenn du Punkte, die du zwei- oder dreimal hintereinander korrekt wiedergegeben hast, nicht mehr testest. Weiterer Vorteil eines Lernpartners: Wenn du ihn/sie abfragst, lernst du unbewusst und ohne Anstrengung mit!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Welcher Lerntyp bist du?

Ist dir schon mal aufgefallen, wie unterschiedlich die Handschriften deiner Freunde und Kommilitonen aussehen?
Frauen haben in der Regel eine schöne (und vor allem lesbare) Handschrift und neigen dazu, ihren Textmarker zu sehr zu beanspruchen. Das sieht dann für Männer manchmal aus wie Malen nach Zahlen statt eines Skripts für Buchführung.
Bei Männern hingegen geht die Handschrift oftmals ins hyroglyphenartige über. Die Handschriften sind unordentlich und farblos und die meisten lernen sowieso nur noch am Computer. Mit Onlineversionen und ganz ohne Handschriften werden da Druckkosten und Skriptpreise gespart
Von: Max
Der Grund für diese Unterschiede im Stil und in den Anwendungsmethoden von Lernmedien ist eigentlich ganz einfach und nicht unbedingt geschlechterbezogen - es gibt einfach verschiedene Lerntypen. Das wird dich vielleicht nicht überraschen. Du wusstest schon immer, wie deine Hefter und später auch Skripte auszusehen hatten, um optimale Lernerfolge zu erreichen. Vielleicht geht es dir aber auch wie mir – ich hatte mich immer ein bisschen gewundert, warum es einem leicht fällt für ein bestimmtes Fach zu lernen aber nicht für ein anderes.
Die Lösung für dieses Problem ist eigentlich ganz einfach. Du musst deine Unterlagen einfach deinem Lernstil entsprechend bearbeiten, wenn sie ihm nicht entsprechen. Doch zu welchem Lerntyp gehörst du? Um das herauszufinden, schaust du dir einfach die vier folgenden Typen an und überlegst, welcher am ehesten auf dich zutrifft:
Der visuelle Lerntyp:
Du lernst am besten, wenn der Lernstoff aufgeschrieben oder bildlich wiedergegeben wird? Diagramme, Mind Maps und Schaubilder helfen dir, dich an Sachverhalte leichter zu erinnern? Beim Schauen der Nachrichten im Fernsehen bleibt mehr hängen, als bei Radionachrichten? Dann bist du ein visueller Lerntyp. Du solltest deine Unterrichtsmaterialien bzw. deine Buchführung so gestalten, dass sie möglichst gut visuell zu verinnerlichen sind. Textmarker, ein Flipchart oder eine Tafel können dir helfen den Lernstoff leichter zu verarbeiten.
Ein weiterer Hinweis auf den visuellen Lerntyp können deine Hobbies sein. Photographie ist zum Beispiel ein Medium, das deutlich auf einen visuellen Typ hinweist.
Der auditive Lerntyp:
Der Versuch mit den Nachrichten funktioniert hier genau umgekehrt. Du merkst dir mehr bei Radionachrichten, als im Fernsehen? Lehrende mit einer starken, ausdrucksvollen Stimme sind dir am Liebsten? Du bist ein Fan von Hörspielen? Dann bist du ein auditiver Lerntyp. Für dich ist Lernen in der Gruppe sinnvoll, weil du anderen beim Erklären zuhören kannst. Auch wenn du selber erklärst, kannst du gut auswendig lernen. Sprachen kannst du mit Hilfe von Lern-CDs und Onlineportalen sehr gut aufnehmen. Deine ideale Lernumgebung ist ruhig, da dich Hintergrundgeräusche wie ein Fernseher oder Gespräche, die nichts mit dem Lernstoff zu tun haben, ablenken. Die farbliche Gestaltung deiner Unterlagen wäre hingegen reine Zeitverschwendung.
Du solltest beim Lernen den Stoff wie ein Gedicht aufsagen oder dir auf Band sprechen. Das klingt im ersten Moment seltsam und sieht für Aussenstehende sicher auch witzig aus ("Hallo, Selbstgespräch!") aber du wirst sehen, dass es hilft.
Der kommunikative Lerntyp:
In Gruppendiskussionen blühst du auf? Komplizierte Sachverhalte verstehst du besser, wenn du mit Kommilitonen darüber sprichst und alleine im Zimmer sitzen führt eher zu Depressionen als zu den 25 neuen Vokabeln für den Englischtest morgen? Dann bist du ziemlich wahrscheinlich ein Kommunikativer Lerntyp. Für dich sind Lerngruppen ideal um dich auszutauschen. Gruppenarbeit und Abfragen von neuem Lernstoff sind für dich die beste Vorbereitung. Versuch in deinem Bekanntenkreis in der Uni “Gleichgesinnte“ zu finden und bildet eine Lerngruppe. Tipps dazu findest du auch unten im Link „Wie lernst du am besten? Allein oder in der Gruppe?“.
Der motorische Lerntyp:
Du kannst einfach nicht still sitzen und dich konzentrieren? Du lässt dich schnell ablenken und verlierst das Interesse am Lernen? Beim Auswendiglernen im Zimmer fällt dir nur die letzte Party ein und auf dem Bett lernen führt unweigerlich zu einer kleinen “Ruhepause“.
Du hantierst in der Vorlesung ständig mit einem Stift rum? Dann bist du höchst wahrscheinlich ein motorischer Lerntyp. Für dich bedeutet Bewegung Lernerfolg. Selbst wenn du Gefahr läufst, wie ein Tiger im Käfig auszusehen - im Zimmer auf und ab gehen hilft dir, komplizierte Sachverhalte zu lernen. Deine Vokabeln zu nehmen und einfach loszuspazieren, frische Luft und aktiv sein, unterstützt deine kognitiven Fähigkeiten.
Achtung!
Eine blosse Reduktion des Lernerfolges auf die einzelnen Lerntypen ist natürlich nicht möglich. Zum einen beeinflussen viele verschiedene Faktoren die besten Lernerfolge und ausserdem lernen wir nie mit nur einem Sinn, es handelt sich vielmehr um eine Kombination. Den Unterrichtsstoff seinem eigenen Lernstil entsprechend zu verarbeiten ist aber bereits ein grosser Schritt in die richtige Richtung.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Wie lernst du am besten? Allein oder in der Gruppe?

Wie man am besten lernen und sich auf Prüfungen vorbereiten kann, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Grob kann man die meisten Studenten jedoch in zwei Arten einteilen: die Individualisten und die Kollektivisten.
Von: Max
Für den Individualisten ist die Arbeit in der Gruppe, das gemeinsame Lernen oder Vorbereiten von Referaten zusammen mit anderen mehr Qual als Freude. Abhängig zu sein gefällt ihm nicht, und sein Lerntempo an andere anzupassen nervt ihn gehörig. In der Regel ist er gut organisiert und hat keine Motivationsprobleme.
Kollektivisten hingegen finden nichts besser als in der Gruppe zu studieren. Frei nach dem Motto “geteiltes Leid ist halbes Leid“ motivieren sie sich gegenseitig und haben nicht das Gefühl, etwas zu verpassen, weil man der einzige ist, der gerade NICHT am See liegt und die Sonne geniesst. Fragen, die man vielleicht in der Vorlesung zu stellen sich nicht getraut hat, können in der Gruppe diskutiert werden und man gibt nicht so schnell auf, weil die anderen einen mitziehen und pushen.
Zu welcher Gruppe man gehört stellt sich in der Regel schon früh im Studium, wenn nicht schon in der Schule, heraus. Je früher man es weiss, umso besser ist es, weil man vom ersten Tag an in der Uni durchstarten kann und sich optimal auf das Lernen vorbereiten kann.
Die Individualisten haben es dabei ein bisschen leichter als die Kollektivisten. Sie nehmen sich einfach das Skript und fangen an. Die Kollektivisten müssen erstmal eine Lerngruppe finden oder eine solche gründen.
In der Regel ist das für aufgeschlossene Studenten, wie sicher auch du eine/r bist, kein Problem. Trotzdem gibt es einige Dinge, die zu beachten sind:
Zuerst einmal musst du deine Mitstudenten kennen lernen, um festzustellen, ob er oder sie sich für die Gruppenarbeit eignet, oder nicht. Wichtige Fragen bzw. Kriterien hierfür sind:
Ist das potentielle Mitglied...?:
- motiviert
- gut im entsprechenden Fach
- zuverlässig
- fähig, zuzuhören und sich aktiv mitzubeteiligen
- vor allem: kannst du dir vorstellen mit ihm zusammenzuarbeiten?
Hast du erst einmal potentielle Kandidaten ausgemacht, dann solltest du etwa 3-5 von ihnen fragen, ob sie nicht Lust und Zeit hätten, eine Lerngruppe mit dir zu bilden. Es sollten nicht mehr als 5 sein, da sonst der Koordinationsaufwand zu gross und effektives Arbeiten schwieriger wird.
Wenn ihr euch dann “gefunden“ habt, muss geklärt werden:
- WIE oft
- ihr euch WO
- und WANN
- für WIE LANGE trefft
- und WELCHES LEVEL eure Vorbereitung haben sollte
Da es sich um eine Lerngruppe handelt, ist oftmals ein gewisses Organisations-/Koordinationsgeschick nötig um alle unter einen Hut zu bekommen.
Wenn ihr es geschafft habt und euch das erste Mal trefft, steht einer erfolgreichen Lernsitzung eigentlich nichts mehr im Wege.
Und trotzdem gibt es noch einige Tipps, die ich euch noch mitgeben möchte, da ich weiss, wie frustrierend eine schlechte Lerngruppe oder ein schlechtes Treffen gerade kurz vor einer Klausur sein kann!
- schreibt als erstes eine Agenda auf (das klingt zwar erstmal etwas komisch, hilft aber enorm, sich nicht zu verzetteln)
- steckt euch Ziele, die ihr in einem Gruppentreffen erreichen wollt
- vergleicht später, was ihr geschafft habt, um ein Gefühl für eure Geschwindigkeit zu bekommen
- lasst das Handy aus (bzw. geht nur im Notfall ran). Ich weiss, dass das die schwierigste Herausforderung ist, aber es bremst euch enorm, wenn alle zwei Minuten jemand am telefonieren ist
- plant Pausen ein
- schweift nicht ab, Zeit für Privates habt ihr nach der Lernsitzung noch genug
- wenn ihr euch noch nicht so lange kennt, erstellt eine Liste mit Email-Adressen, Telefonnummern und vielleicht der Adressen der jeweiligen Teammitglieder
Wenn ihr diese Punkte beachtet, dann kann die Gruppenarbeit für euch nur Vorteile haben. Ihr solltet jedoch von vornherein wissen, was für ein Lerntyp ihr seid, um den optimalen Nutzen aus der Gruppe zu ziehen, und auch euren Teil dazu beitragen zu können.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Brainwriting ist das effektivere Brainstorming!
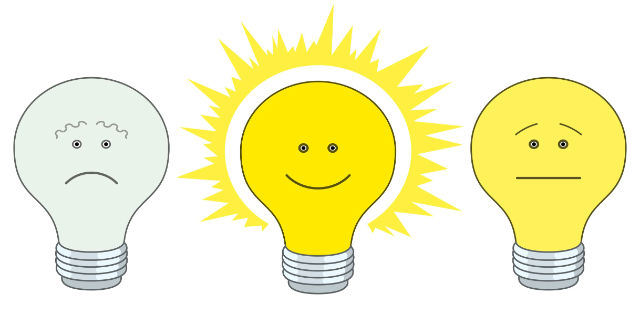 |

Wenn es darum geht, als Gruppe neue Ideen zu generieren, fällt einem meistens als erstes die klassische Brainstorming-Methode ein: Die Gruppenmitglieder sprechen einfach jeden Gedanken aus, egal wie nutzlos dieser zunächst zu sein scheint. Irgendwann -so die Hoffnung- wird schon “der geniale Einfall” dabei sein. Aber ist Gruppen-Brainstorming tatsächlich die effektivste Methode, sinnvolle und originelle Ideen zu entwickeln? Nicht unbedingt!
Von: BrainEffect-Team, 08. Mai 2010
Lernforscher haben in zahlreichen Studien Brainstorm-Gruppen untersucht und festgestellt, dass Studienteilnehmer, die alleine gearbeitet haben, bessere Ergebnisse erzielten als diejenigen, die in der Gruppe Ideen gesammelt haben – sowohl betreffend der Menge als auch der Qualität der Ideen. Dafür gibt es drei Gründe:
1. Furcht vor negativem Feedback
In der Gruppe fällt es nicht immer leicht, die wildesten Ideen auszusprechen, auch wenn gerade solche Ideen oftmals diejenigen sind, die das grösste Potential haben. Man möchte in der Gruppe nicht ausgelacht werden und behält daher die Idee lieber für sich.
2. Kampf der Persönlichkeiten
Brainstorming-Runden können schnell unproduktiv und gar ungemütlich werden, nämlich dann, wenn besonders durchsetzungsstarke Typen sich ins Rampenlicht der Gruppe stellen und die Runde nicht moderieren sondern beherrschen. Oft sind sie dazu noch stur. Passive und schüchterne Teilnehmer kommen so gar nicht zu Wort. Der kreative “Flow”, den man sich durch das Brainstorming erhofft hat, kommt gar nicht erst auf.
3. Ideen-Stau
Beim klassischen Brainstorming kann immer nur ein Teilnehmer reden. Die Folge: Während ein Brainstormer seine Idee vorstellt, fangen die anderen an, ihre Ideen unbewusst anzupassen, zu verändern oder sie vergessen sie sogar. Denn unserem Gehirn fällt es schwer, mehreren Ideen gleichzeitig aufmerksam zu folgen. Insgesamt werden dadurch also weniger Ideen produziert als wenn man alleine Ideen sammelt.
Wenn es also stimmt, dass das klassische Brainstorming alleine besser funktioniert als in der Gruppe, sollten wir das Ideensammeln in der Gruppe ganz aufgeben? Oder gibt es einen Weg, die offensichtlichen Vorteile der Gruppendynamik zu nutzen, während man die soeben genannten Nachteile vermeidet?
An dieser Stelle setzt das sogennante Brainwriting an. Denn anders als beim Brainstorming denkt und schreibt beim Brainwriting jeder Teilnehmer selbst, keinerlei verbale Kommunikation findet in der Ideenfindungsphase statt. Konkret funktioniert das Brainwriting so: Die Brainwriting-Teilnehmer sitzen gemeinsam an einem Tisch und jeder bekommt ein Blatt Papier. Oben auf diesem Blatt steht bei jedem Teilnehmer die selbe Fragestellung bzw. Problematik. Der Brainwriting-Moderator gibt nun jedem Teilnehmer 3 Minuten Zeit jeweils 3 Ideen auf das Blatt Papier zu schreiben. Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die Blätter zu der jeweils links sitzenden Person weitergegeben. Jetzt beginnt eine neue Brainwriting-Runde. Jeder schreibt 3 neue Ideen unter die des Nachbarn, welche als Inspiration genutzt oder einfach ignoriert werden können. Das Ganze kann immer so weiter gehen bis die Brainwriting-Teilnehmer denken, dass sie genug Ideen gesammelt haben. Nach der Ideenfindungsphase werden alle Ideen vorgelesen, besprochen und vom Brainwriting-Moderator zusammengefasst.
Die Vorteile vom Brainwriting gegenüber dem klassischen Brainstorming sind:
- Beim Brainwriting werden viel mehr Ideen produziert. Zur Veranschaulichung: Mit der Brainwriting-Methode kann man bei 6 Teilnehmern und 3 Ideen alle 3 Minuten ganze 90 Ideen in 15 Minuten generieren.
- Ideen werden beim Brainwriting sofort festgehalten. Sie gehen nicht verloren während andere Teilnehmer ihre Ideen vorstellen.
- Alle Teilnehmer kommen beim Brainwriting zu Wort und alle Beiträge bekommen die selben Chancen.
- Die Ideen können anonym vorgestellt werden, daher kann sich beim Brainwriting jeder trauen, auch mal verrückte Ideen einzubringen.
- Die Zeitbegrenzung beim Brainwriting gibt den Teilnehmern einen leichten Druck, Ideen zu liefern und führt daher zu einer Produktivitätssteigerung.
Wenn es also darum geht, dir ein Hausarbeits-, oder Abschlussthema auszudenken, setze dich doch mit Kommillitonen zusammen, die vor der selben Frage stehen, und starte mit ihnen eine Brainwriting-Sitzung.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Mind Maps

Eine Mind Map ist ein Diagramm, das Stichwörter, Ideen, Aufgaben oder andere Elemente um ein zentrales Wort oder Konzept in Verbindung bringt. Mind Maps werden genutzt, um Konzepte oder Ideen zu veranschaulichen, zu bewerten und zu gliedern, um sich die Inhalte besser vorstellen und merken zu können. Somit dienen Mind Maps als Hilfe beim lernen, schreiben, brainstormen oder auch bei Problemlösungen. Eine Mind Map ist eine hervorragende Technik, wenn du dir ein Wissensgebiet strukturiert aneignen musst, zum Beispiel, um eine Klausur oder mündliche Prüfung vorzubereiten.
Von: Sebastian
Es werden Stichwörter, Ideen, Aufgaben oder andere Elemente um ein zentrales Wort oder Konzept gruppiert. Dies kann klassisch auf einem einfarbigen Blatt Papier oder mit Hilfe eines Mind Mapping Progamms am Rechner sein. Das Hauptthema wird in die Mitte eines Blattes oder Plakates geschrieben.
Die Elemente einer Mind Map werden spontan angeordnet, wobei die Wichtigkeit des jeweiligen Elements zählt. Bei der Darstellung von semantischen Zusammenhängen entstehen graphische Verbindungen wie zum Beispiel Cluster oder Zweige. Da Zusammenhänge intuitiv dargestellt werden können, haben Mind Maps den Vorteil, dass bereits bearbeitete Inhalte schneller wiederverwendet werden können. Dabei ist wichtig, dass man in der Mind Map einerseits unterschiedliche Farben verwendet und andererseits mit Symbolen, Zeichnungen und Bildern arbeitet. Die Wirkung dieser Maßnahme ist wissenschaftlich nachgewiesen. Der Vorteil davon, graphisch mit Farben zu arbeiten, ist, dass nicht nur die linke Gehirnhälfte angesprochen wird.
Sie ist für analytisches und rationales Denken, Logik und Details zuständig. Auch die rechte Gehirnhälfte wird aktiviert, die für Kreativität, nichtlineares Denken und bildliche Vorstellungskraft zuständig ist. Wenn beide Gehirnhälften zusammen arbeiten, nutzt du quasi dein ganzes Pensum zum lernen.
In Mind Maps werden also Ideen strahlenförmig, graphisch und nichtlinear dargestellt. Diese Herangehensweise macht Mind Maps auch für Brainstorming oder Planung organisatorischer Abläufe interessant. Die nichtlineare Anordnung der einzelnen Äste sprengt den üblichen Darstellungsaufbau, der typischerweise in linearer, hierarchischer Form angelegt wird. Diese Eigenschaft verleiht der Mind Map beim Brainstorming den Vorteil, Konzepte und Ideen aufzuführen und miteinander zu verknüpfen, ohne sich dabei an eine vorgegebene Struktur halten zu müssen. Hierdurch können neue Strukturen erschlossen und neue Zusammenhänge gebildet werden.
Diese Eigenschaft der Mind Map verleiht ihr beim Brainstorming zusätzlich den Vorteil, schnell und unkompliziert zu sein. Du musst dir keine grossen Gedanken um die Strukturierung machen.
Ausserdem können unterschiedliche Konzepte und Ideen aufgeführt und miteinander verknüpft werden, ohne sich dabei an eine vorgegebene Struktur halten zu müssen. Hierdurch können neue Strukturen erschlossen und neue Zusammenhänge gebildet werden. Die Anwendungsmöglichkeiten von Mind Maps sind aber noch umfangreicher! So kannst du mit Hilfe von Mind Maps komplizierten Lernstoff übersichtlich aufbereiten und besser lernen.
Probiere die Mind Mapping Technik einfach mal aus! Es gibt bestimmt ein Projekt, das gerade dargestellt, oder eine Präsentation die strukturiert werden muss. Du wirst schnell merken, wie einfach und effektiv Mind Mapping ist. Im Internet finden sich übrigens verschiedene kostenlose Mind Map Programme.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Brainwriting-Pool und 6-3-5 Methode
 |

Brainstorming kennt jeder und es ist aus dem gemeinschaftlich-kreativen Arbeiten nicht wegzudenken. Weniger bekannt ist das Brainwriting, das hier vorgestellt wird.
Von: Sebastian
Brainwriting unterscheidet sich vom klassischen Brainstorming darin, dass die Ideen – wie der Name schon sagt – schriftlich festgehalten werden. Anschliessend erhält jeder Teilnehmer die Chance, alle anderen Ideen zu lesen und diese -weiterhin schriftlich- zu ergänzen, zu verändern oder sich von ihnen zu neuen eigenen Ideen inspirieren zu lassen. Erst nachdem jeder Teilnehmer der Brainwriting-Runde Zeit hatte, über jede Original-Idee nachzudenken, wird die mündliche Diskussion gestartet.
Die Vorteile des Brainwriting: jeder hat dieselbe „Redezeit“, deshalb kommen beim Brainwriting auch die stilleren Teilnehmer gleichermassen zu Wort. Entstehen zwei gute Ideen gleichzeitig, wird nicht die eine durch die andere totgeredet. Bei manchen Brainwriting-Methoden bleiben die Urheber anonym, sodass kein Urheber bevorzugt oder benachteiligt wird.
Besonders einfach zu handhaben ist die Brainwriting-Methode 6-3-5, da ihre Regeln für eine klare Struktur sorgen: 6 Personen haben jeweils für 3 Ideen 5 Minuten Zeit. Konkret heisst das: Ihr braucht pro Person ein Blatt, am besten mit einer vorbereiteten Tabelle von 6 Zeilen und 3 Spalten. Nun hat jeder 5 Minuten Zeit, um auf seinem Blatt 3 Ideen zu notieren. Danach werden die Zettel kreisförmig reihum zum Nachbarn gereicht. Dieser schreibt nun unter jede Idee, was ihm dazu einfällt. Nach weiteren 5 Minuten gehen die Blätter weiter zum Nächsten usw. Nach 30 Minuten Brainwriting haben alle Teilnehmer jede Idee gesehen und ergänzt. Natürlich funktioniert diese Brainwriting-Methode auch mit anderen Teilnehmerzahlen.
Nicht ganz so strukturiert, dafür anonym ist der Brainwriting-Pool. Dabei werden Ideen aufgeschrieben und dann in der Tischmitte – dem Pool – abgelegt. Wem gerade nichts eigenes einfällt, nimmt sich einen Zettel aus dem Pool; fällt ihm dazu etwas ein, schreibt er es darunter und legt das Blatt zurück. Das Brainwriting wird fortgesetzt, bis niemand mehr irgendwo etwas anmerken möchte. Um die Anonymität weitgehend zu gewährleisten, helfen gleichartige Stifte und Druckschrift.
Selbstverständlich sind abwertende Kommentare tabu! Nur so entwickelt Brainwriting seine Stärke: eine Lösungsfindung, an der wirklich jeder in der Runde maßgeblich mitgewirkt hat.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Synektik - Kreativität ist planbar!

Ob für Eselsbrücken, Merksprüche, Bewerbungsschreiben oder Hausarbeiten - für ein erfolgreiches Studium und alles was darauf aufbaut ist Kreativität der Grundstein. Die gute Nachricht: Kreativität lässt sich erlernen! Schon Friedrich Dürrenmatt erkannte: "Kreative Phantasie arbeitet durch ein Zusammenwirken von Erinnerung, Assoziation und Logik."
Theoretisch also ganz einfach ... und wie es praktisch geht, lest ihr im folgenden Text!
Von: Sebastian
Wenn du ein Problem kreativ löst, verknüpfst du zusammenhangloses Wissen zu neuen Mustern. Dieser Denkprozess läuft häufig unbewusst und somit ohne Struktur ab. Die Synektik teilt den Denkverlauf in Phasen und hilft so, die Gedanken bewusst anzuregen. Du kannst die Methode allein anwenden oder in der Gruppe, geleitet von einem erfahrenen Moderator. In der Vorbereitung solltest du beachten, dass die Synektik-Technik Zeit und auch ein wenig Übung braucht, damit sinnvolle Analogien gebildet werden.
Die Problemlösung mittels Synektik durchläuft 10 Stufen, die mehr oder weniger Zeitaufwand benötigen. Während dieser Schritte wird das Problem mittels Analogien mehr und mehr verfremdet, um zuletzt die gewonnenen Gleichnisse und Parallelen mit dem Problem logisch zu verknüpfen, um eine kreative Lösung zu entwickeln.
Synektik – Phase 1: Problem analysieren
Das Problem wird untersucht und genau aufgezeigt, Fragen der Gruppe werden geklärt.
Beispiel: Scheinwerfer verschmutzen während der Fahrt
Synektik – Phase 2: Spontane Lösungen finden
Mittels Brainstorming aufgekommene spontane Lösungen werden dokumentiert, dazu verwendest du am besten ein Flipchart, damit alle Teilnehmer die Notizen sehen und die Sitzung strukturiert wird.
Beispiel: Scheibenwischer für die Scheinwerfer
Synektik – Phase 3: Das Problem neu formulieren
Die Gruppe beschreibt das Problem gemeinsam neu.
Beispiel: Wie kann die Verschmutzung der Scheinwerfer verhindert werden?
Die Phase der ausgiebigen Beschäftigung mit dem Problem ist jetzt abgeschlossen. Nun entfremdest du dich vom Problem und abstrahierst.
Synektik – Phase 4: Direkte Analogie finden
Aus einem vorgegebenen Themenbereich entwickelt die Gruppe erste direkte Analogien, bei einem technischen Problem häufig aus dem sozialen Bereich oder der Natur. Alle Gruppenmitglieder sollten mit dem Themengebiet vertraut sein.
Beispiel: Wo in der Natur erfolgt eine ständige Entfernung von Oberflächenbelag? Regen, Wind, Flüsse
Synektik – Phase 5: Persönliche Analogie finden
Die Gruppe wählt ein direktes Gleichnis aus, identifiziert sich damit und entwickelt eine persönliche Analogie.
Beispiel: Wie fühlst du dich als Wind? Du bist frei, du stürmst und reisst weg, du umschlingst Grashalme, stösst gegen Berge und pfeifst um die Häuser, du jaulst, braust, schmeichelst.
Synektik – Phase 6: Symbolische Analogie finden
Eine persönliche Analogie wird von der Gruppe ausgewählt und auf ungewöhnliche, paradoxe oder symbolische Vergleiche eingehend geprüft, ähnlich der Suche nach einem Buchtitel.
Beispiel: umschlingen - begrenzte Freiheit, haltlose Festigkeit (als Paradoxon), Fessel (als Symbol), sanfter Zwang
Synektik – Phase 7: Zweite direkte Analogie finden
Die Gruppe sucht jetzt wieder direkte Analogien aus dem Themengebiet, aus dem die Aufgabe stammt, hier also aus dem Bereich der Technik.
Beispiel: Wo in der Technik gibt es sanften Zwang? Segelflugzeug, Rasierklinge, Bremse
Nachdem du dich mit diesen Schritten vollständig vom Problem entfernt hast, kannst du nun Assoziationen und neue Denkmuster entwickeln.
Synektik – Phase 8: Die direkte Analogie analysieren
Merkmale und Funktionsprinzipien einer ausgewählten Analogie aus dem 7.Schritt werden von der Gruppe aufgelistet und analysiert.
Beispiel: Segelflugzeug nutzt den Wind aus, Tragflächen und Steuerruder lenken mittels Wind und halten das Flugzeug in der Luft
Synektik – Phase 9: Auf das Problem übertragen
Jetzt musst du einen Zusammenhang zwischen den Analogien und deinem Problem finden - der wichtigste Schritt.
Beispiel: Was hat das Segelflugzeug mit den Scheinwerfern zu tun? Die Form des Scheinwerfers könnte den Wind nutzen, um die Oberfläche zu säubern oder nicht erst zu verschmutzen.
Synektik – Phase 10: Die Lösungsansätze formulieren
Aus den entwickelten Ideen werden die Lösungsansätze formuliert und weiter ausgearbeitet.
Beispiel: Ein Scheinwerfer mit konischer Oberfläche, um dem Wind und dem Schmutz keine Angriffsfläche zu bieten. Oder ein Scheinwerfer, der durch den Fahrtwind ein Luftpolster auf der Oberfläche erzeugt, so dass keine Schmutzpartikel anhaften können.
Du siehst, die Synektik ist eine anspruchsvolle Denkmethode, die dir mit ein wenig Übung wertvolle, kreative Problemlösungen liefern kann. Die Analogien verschaffen dir einen Abstand und erzeugen so ungeahnte Lösungsansätze. Probier es mit Freunden oder allein im Selbstversuch einfach mal aus.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Welcher Master ist der richtige? - Kriterien & Masterstudiengänge an der Uni Luzern
 |

Kriterien und Masterstudiengänge an der Uni Luzern
Von: Judith Lauber
Kriterien können sein:
- Konkrete Inhalte des Studienganges (Curriculum)
- Ort (Inland, Ausland, Sprache, Entfernung von zu Hause)
- Betreuungsverhältnis
- Wohnen
- Arbeitsmöglichkeit neben dem Studium
- Dauer des Masterstudiums
- Praxisorientiertes Studium
- Wissenschaftsorientiertes Studium (für Wissenschaftslaufbahn)
- Ruf der Uni (eventuell wichtig für Arbeitgeber)
- Ranking
- Infrastruktur
Masterstudiengänge an der Universität Luzern
- Geschichte
- Judaistik
- Kirchenmusik
- Kultur- und Sozialanthropologie / Ethnologie
- Kulturwissenschaften
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Wie viel Salär ist drin?
 |

Die Gehaltsfrage ist für viele Absolventen ein unsicheres Terrain. Über Einkünfte spricht man lieber nicht, Geld ist vor allem für Schweizer ein Tabuthema. Künftige Arbeitgeber erwarten jedoch von Absolventen, dass sie im Einstellungsgespräch beim Gehaltswunsch Farbe bekennen. Damit die Gehaltsfrage im Vorstellungsgespräch nicht zu einem Intermezzo mit hochrotem Kopf und Stammeleinlagen wird, sollten sich Absolventen gezielt vorbereiten.
Von: Anna Hollmann, CEO von academics 4 business
Wer sein Studium abgeschlossen hat, vielleicht sogar mit sehr guten Noten, einen Auslandsaufenthalt und Praxiserfahrung vorweisen kann, hat gute Karten im Gehaltsgespräch. Dabei müssen Bewerber bei allem Selbstbewusstsein allerdings auf dem Teppich bleiben. Sie sollten auf die Frage nach dem Salär realistische Zahlen nennen und an der richtigen Stelle über das Gehalt reden. Es ist nämlich nicht üblich, dass Absolventen die Gehaltsfrage im Vorstellungsgespräch selbst stellen. Der Bewerber sollte das Thema Geld erst dann ansprechen, wenn er gefragt wird, und die Initiative lieber dem Interviewpartner überlassen.
Denn klar ist: Arbeitnehmer sind an engagierten und motivierten Absolventen interessiert, denen es um das Unternehmen und die Arbeitsinhalte geht – und nicht in erster Linie ums Geld. Bei Absolventen gibt es ohnehin meist einen geringeren Spielraum für Verhandlungen als bei Berufserfahrenen. In der Regel wissen Unternehmen recht genau, was sie Einsteigern zahlen möchten. Meist haben Absolventen nicht allzu viel Praxiserfahrung, die sie in die Waagschale werfen können. Es gibt aber durchaus Ausnahmen, die mehr erwarten können, besonders wenn sie ein sehr zielgenaues und mit vielen praktischen Erfahrungen fundiertes Profil mitbringen. Je besser sich ein Kandidat in einer Branche und mit seinen angehenden Aufgaben auskennt, umso weniger Einarbeitung ist nötig – was sich wiederum für den Arbeitgeber auszahlt.
In jedem Bewerbungsprozess werden die Kandidaten irgendwann gefragt, welche Gehaltsvorstellungen sie haben. Tendenziell erfolgt diese Frage gegen Ende des Bewerbungsprozesses. Es ist jedoch ratsam, sich bereits vor dem Gespräch auf die Salärfrage vorzubereiten. Antworten wie «Das Gehalt ist für mich nicht so wichtig» oder «Das ist schwer zu sagen, ich kenne mich mit den Zahlen nicht aus» machen einen schlechten Eindruck und wirken unprofessionell. Viele Absolventen sind sich unsicher, welches Einstiegssalär sie verlangen können. Und mit nur wenig Arbeitserfahrung ist es in der Tat schwieriger, seinen Marktwert realistisch einzuschätzen. Trotzdem gibt es Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Eine Vorstellung davon, welches Gehalt angemessen ist, bieten zum Beispiel die Erhebungen des Bundesamtes für Statistik, die das Bruttojahreseinkommen von Schweizer Absolventen nach Fachrichtungen ermitteln (www. bfs.admin.ch).
Allerdings sollte man diese Angaben grundsätzlich mit Vorsicht behandeln, da sie lediglich einen statistischen Trend wiedergeben können. Je nach Branche, Unternehmen, Studienrichtung, Region und Zusatzqualifikationen (Praktika, Sprachen, IT-Skills etc.) können die Einstiegsgehälter extrem variieren. Als Orientierungshilfe sind Statistiken jedoch sehr nützlich, da man sie im Gespräch als Referenzgrösse angeben kann. Entscheidend für die Höhe des Gehalts ist neben der individuellen Qualifikation natürlich auch die Grösse und die Branche des jeweiligen Unternehmens sowie die spezifischen Aufgaben- und Verantwortungsbereiche. Häufig muss man für ein hohes Einstiegsgehalt auch Opfer bei der Freizeitgestaltung in Kauf nehmen und sehr flexibel sein.
Die Wahl des ersten Arbeitgebers ist von zentraler Bedeutung für die spätere berufliche Entwicklung. Ich rate daher Absolventen, sich eine Einstiegsposition zu suchen, die ihren Stärken entspricht, in der sie von erfahrenen Kollegen möglichst viel lernen können und individuell gefördert werden. Das erste Gehalt sollte dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Entscheidend ist nicht, was man in seiner ersten Position verdient (auch wenn dies unter Umständen Freunde und Kollegen beeindruckt), sondern wo man fünf Jahre später steht und was man bis dahin gelernt hat. Den Gehaltssprung, den man in der Regel bei seinem nächsten Entwicklungsschritt macht, ist meist umso erfreulicher.
Steht ein Absolvent vor dem Dilemma, ob er einen schlecht bezahlten Traumjob mit spannenden Entwicklungsperspektiven annehmen soll oder nicht, empfehle ich, bei den Vertragsverhandlungen eine automatische Gehaltserhöhung nach Ablauf der Probezeit einzubauen.
Über academics 4 business
«academics 4 business» ist eine Plattform für junge Talente und Unternehmen. Studierende und Absolventen werden auf ihrem Weg in ein erfolgreiches Berufsleben aktiv gefördert und begleitet. Für Unternehmen bietet „academics 4 business“ Unterstützung bei der Hochschulrekrutierung und im Hochschulmarketing sowie bei der Entwicklung von Talent-programmen an. Zusätzlich unterstützt «academics 4 business» Schweizer Hochschulen bei der Karriereberatung ihrer Studierenden konzeptionell und durch Informationsveranstaltungen. www.academics4business.ch
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Studieren in Bologna-Zeiten
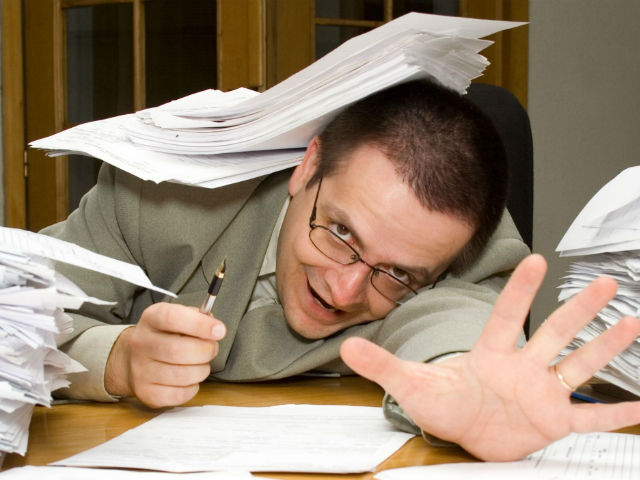 |

Die Bologna-Krise will nicht enden: Mal sind es die Dozenten, die über die Straffung der Lehrinhalte klagen, mal kritisieren Parteien und Verbände die schlechte Umsetzung der Reformen, dann wieder sind es die Studierenden selbst, die dem Thema mit deutlichen Protesten und Hörsaalbesetzungen mediale Aufmerksamkeit verschaffen. Und nun sind es die Statistiker des Hochschul-Informations-Systems in Deutschland (HIS), die ernüchternde Zahlen zu den Problemen beim Bachelor-Studium vorlegen.
Von: Alice Werner
Geschimpft wurde auf die Uni eigentlich schon immer. Am lautesten vielleicht von jenen Deserteuren, die ihr Studium leichten Herzens sausen liessen. Einer, der bereits nach den ersten Studienmonaten genug von der Wissenschaft hatte, war Gustave Flaubert. 1842 schrieb er in einem Brief: «Die Rechtswissenschaften bringen mich um, verblöden und lähmen mich. (…) Wenn ich drei Stunden meine Nase in das Gesetzbuch gesteckt habe, ist es mir unmöglich noch weiter fortzufahren: Ich würde sonst Selbstmord begehen.» Auch andere prominente Studienabbrecher lassen kein gutes Haar am universitären Betrieb. In seinem Buch „Über die Müdigkeit“ zieht Peter Handke über sein Studium in Graz her: «Es war in der Regel weniger die schlechte Luft und das Zusammengezwängtsein der Studentenhunderte als die Nichtteilnahme der Vortragenden an dem Stoff, der doch der ihre sein sollte. Nie wieder habe ich von der Sache so unbeseelte Menschen erlebt wie jene Professoren und Dozenten der Universität (…).» Selbst Bill Gates liess einmal verlauten, er habe sein Mathematikstudium an der Harvard-Universität aufgegeben, weil das ernsthafte Streben nach einem Abschluss unter seinen Kommilitonen als «uncool» galt. Solche Argumente spielen bei den heutigen Studienabbrechern keine Rolle mehr. Ihre Gründe für die Aufgabe des Studiums sind wesentlich ernsthafter. In ihrer aktuellen Studie zeigen die HIS-Experten auf, dass vor allem Leistungsprobleme und mangelnde Motivation für den Abbruch eines Bachelor-Studiums verantwortlich sind.
Leistungsdruck für Studierende
Im Studienjahr 2008 hatten die Forscher um Projektleiter Dr. Ulrich Heublein 2‘500 Studienabbrecher an 54 Universitätenund 33 Fachhochschulen in Deutschland zu den Hintergründen ihrer Entscheidung befragt und die Antworten mit Angaben aus dem Jahr 2000 verglichen. Die Ergebnisse stützen die Bologna-Kritiker, die den Bachelor als verschult und zweckorientiert verunglimpfen. So sind der neuen Untersuchung zufolge 31 Prozent der Studienabbrecher aus Gründen der Überforderung gescheitert. Dies ist ein Anstieg von elf Prozentpunkten im Vergleich zum Studienjahr 2000. Auch mangelnde Studienmotivation (18 Prozent) und Unzufriedenheit mit den Studienbedingungen (12 Prozent) wurden 2008 häufiger als Gründe für einen Studienabbruch genannt als acht Jahre zuvor.
Eine entsprechende Untersuchung für die Schweizer Hochschullandschaft steht bislang noch aus. Allerdings geben Auskünfte von Studienbetreuern und Fachpsychologen der Universitäten Zürich, Bern, Basel und St. Gallen erste Hinweise darauf, dass sich die Situation hierzulande ähnlich verhält. «Wir erheben diesbezüglich keine statistischen Daten», erläutert Dr. Sandro Vicini, Leiter der Beratungsstelle der Berner Hochschulen, «aber unser klinischer Eindruck ist tatsächlich, dass die Belastung der Studierenden seit Einführung der Bologna-Reform deutlich zugenommen hat.» Zu Stress führe vor allem die Tatsache, dass ein Bachelor-Studiengang Vollzeitanwesenheit erfordere – ein grosses Problem für Studierende, die neben dem Lernen noch Geld verdienen müssten. «Die Doppelbelastung Studium und Nebenjob ist für viele kaum zu bewältigen.»
Die Arbeit ballt sich
Auch Dr. Michaela Esslen, Studienkoordinatorin am Psychologischen Institut der Uni Zürich, stellt fest, dass Bachelor-Studenten häufig an ihre Grenzen stossen: «Der sogenannte Workload, also die Arbeitszeit, die Studierende zur Bearbeitung eines Moduls aufwenden müssen, ist nicht gleichmässig über das ganze Semester verteilt, sondern ballt sich gegen Ende der Vorlesungszeit – denn jedes Modul muss im Bologna-System mit einem Leistungsausweis abgeschlossen werden. Wenn mehrere Prüfungen anstehen, bringt das viele Studierende in Stresssituationen.» Im Frühjahrssemester 2009 führte Esslen eine repräsentative Studienbefragung zum Bachelor-Studium durch. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Druck, sein Studium in der Regelstudienzeit abzuschliessen, tatsächlich gestiegen ist. «Während die meisten der Liz-Studierenden sechs bis sieben Jahre bis zum Studienabschluss brauchten, versuchen fast alle Bachelor-Studierende, die Regelstudienzeit von drei Jahren einzuhalten – obwohl es auch im Bologna-System allen offensteht, teilzeitlich und dafür etwas länger zu studieren», sagt Esslen. «Aber offenbar stehen Studierende, die die Regelstudienzeit überschreiten, unter einem grösseren Rechtfertigungsdruck als früher.»
Als Folge dieser dauernden Leistungsforderung tritt nicht selten das ein, was im Fachjargon «studienbezogene Lern- und Arbeitsstörung» heisst. Diese stressbedingten Störungen äussern sich beispielsweise in Problemen mit Zeitplanung und Arbeitsorganisation, Konzentrationsschwierigkeiten, Unsicherheiten bei der Präsentation von Arbeitsergebnissen, Ängsten, den vermuteten wissenschaftlichen Standards nicht zu genügen, oder fehlender Arbeitsmotivation. Die Hochschulforscherinnen Karin Schleider und Marion Güntert von der Pädagogischen Hochschule Freiburg warnen in der aktuellen Ausgabe der «Beiträge zur Hochschulforschung» davor, solche Lernhemmungen zu unterschätzen. Im schlimmsten Fall könnten längere Arbeitsblockaden zu einem Abbruch des Studiums führen.
Natürliche Selektion
Tatsächlich zeigen die Ergebnisse der HIS-Forscher in Deutschland, dass Bachelor-Studierende wesentlich eher ihr Studium an den Nagel hängen (im Durchschnitt nach 2,3 Fachsemestern), als es früher der Fall war. Vor Einführung der Bologna-Reform verliessen die Studienabbrecher erst nach durchschnittlich 7,3 Fachsemestern die Hochschule. Heisst das nun, dass sensible Gemüter und Selbstfinanzierer zwangsläufig auf der Strecke bleiben? Projektleiter Heublein wählt die Worte mit Bedacht: «Im Bachelor Studium scheitern offensichtlich mehr jener Studierenden bereits beim Studieneinstieg, denen es in den bisherigen Diplom- oder Magisterstudiengängen gelungen ist, nach einer längeren Einstiegsphase doch noch im Studium Fuss zu fassen.»
Studieren in Bologna-Zeiten: Wichtiger denn je scheint jetzt zu sein, mit realistischen Erwartungen das Studium zu beginnen, seine Kapazitäten richtig einzuschätzen – und, wenn nötig, rechtzeitig die Notbremse zu ziehen. Ob es sich um Probleme mit der Selbstorganisation, Motivations- oder Konzentrationsmangel handelt – professionelle Hilfe finden Studierende in jedem Fall bei den Psychologischen Beratungsstellen ihrer Universität. In Einzelgesprächen oder Gruppencoachings bieten die Betreuer fachliche Beratung, psychologische Unterstützung und Begleitung in schwierigen Prüfungsphasen an. In Trainingskursen und Workshops können Studierende zudem lernen, ihr Zeit- und Selbstmanagement zu verbessern und Arbeitsstörungen selbstständig zu überwinden. Denn auch wenn es ein Leben nach der Uni gibt und Studienabbrecher heute längst nicht mehr als verkrachte Existenzen gelten – von den Nebenwirkungen einer umstrittenen Reform sollte man sich nicht um den Hochschulabschluss bringen lassen.
|
Der Artikel erschien im "SCROGGIN-career" Ausgabe Nummer 6 -2010. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
10 Tipps um gegen die Muedigkeit anzukaempfen
 |

Permanente Müdigkeit und Konzentrationsschwäche kennt wohl jeder Student. Besonders in der Phase kurz vor den Prüfungen werden die Tage in der Bibliothek immer länger und die Konzentrationsfähigkeit immer kleiner.
Deshalb wollen wir Euch hier unsere in leidvollen Selbstversuchen erprobten Tipps zur Konzentrationssteigerung vorstellen!
Von: BrainEffect-Team
1. Ernähre dich richtig!
Kohlenhydrate machen dich müde, aber viel frisches Essen wie Gemüse oder Obst nicht. Sie versorgen den Körper mit Energie. Deshalb solltest du nicht ganz so viele Kohlenhydrate essen, vor allem Fertiggerichte sind ganz schlecht.
2. Bewege dich viel!
Durch viel Bewegung bleibst du nicht nur fitter, sondern du beugst auch gegen Ermüdung vor. Am besten machst du regelmässig Sport. Gehe auch zwei bis drei Mal wöchentlich ins Fitnessstudio, das hilft. Es gibt viele Möglichkeiten, dich sinnvoll zu bewegen. Am meisten Spaß macht es mit Freunden zusammen.
3. Nimm viel Flüssigkeit zu dir!
Nimm viel Flüssigkeit zu dir, am besten Wasser, dies beugt auch gegen die Müdigkeit vor. Denn dein Körper braucht eine Menge Flüssigkeit, damit er in Topform ist. Täglich zwei bis drei Liter Wasser solltest du schon trinken; am besten jede volle Stunde ein Glas. So vergisst du es auch nicht.
4. Stärke deinen Geist!
Ein regelmäßiges Gehirnjogging wirkt Wunder. Du bleibst somit wacher und wirst nicht mehr so schnell müde. Außerdem wird dadurch deine Konzentrationsfähigkeit gestärkt.
5. Kaffee oder Energiedrinks?
Natürlich kannst du auch Kaffee oder Energiedrinks gegen die Müdigkeit trinken. Dies hilft dir allerdings nur kurzfristig. Du bekämpfst nicht die Wurzel des Problems, und musst diese Getränke regelmäßig trinken. Und bedenke: Ein zu hoher Konsum kann sehr ungesund für dich sein!
6.Gönne dir frische Luft!
Du solltest nicht den ganzen Tag drinnen verbringen, sondern des Öfteren auch mal Zeit in der Natur verbringen. Eine regelmäßige Sauerstoffzufuhr hilft dir ausgezeichnet gegen Müdigkeit. Dies kannst du auch gleich mit einer sportlichen Betätigung im Freien verbinden.
7.Schlafe ausreichend!
Wenn du jede Nacht zu deinen 7-8 Stunden Schlaf kommst, b ist du den Tag über fit. Wenn du zu kurze Zeit schläfst, spürst du eine große Müdigkeit den ganzen Tag. In der Nacht regeneriert dein Körper sich und dazu sollte er auch ausreichend Zeit haben.
8.Nimm eine kalte Dusche!
Wenn du extrem müde bist, duschst du dich am besten eiskalt. Durch das kalte Wasser wird dein Körper wieder in Schwung gebracht.
9.Tanke viel Sonne!
Dein Körper tankt Kraft durch die warme Sonneneinstrahlung. Deswegen solltest du des Öfteren mal raus in die Sonne, das hält deinen Körper wach.
10.Gönne dir Ruhepausen!
Du solltest dir und deinem Körper mehrmals am Tag eine kurze Ruhepause gönnen. Somit kann dein Körper erholen und er wird nicht so schnell müde.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Fritz Marti - Der Schnellstarter in der BKW FMB Energie AG
 |

Schon drei Jahre nach seinem Studienabschluss hat Fritz Marti eine verantwortungsvolle Kaderposition übernommen. Mit SCROGGIN-career sprach der Leiter Backoffice Energy Trading bei der BKW FMB Energie AG über Ein- und Aufstiegschancen in der Energiebranche.
Von: Sabine Olschner
Das Interview mit Fritz Marti
Herr Marti, erzählen Sie uns etwas über Ihren Werdegang?
Ich habe von 1994 bis 2000 an der Universität Bern Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert. Meine Schwerpunkte in BWL lagen auf Personal und Organisation sowie Marketing, in VWL habe ich mich auf den Speziallehrgang Freizeit und Tourismus konzentriert, als Ergänzungsfach habe ich Medienwissenschaften gewählt – im Grunde also ein buntes Sammelsurium. Nach meinem Abschluss habe ich mich vor allem auf Marketingstellen beworben, meist in Richtung strategisches Marketing und strategische Unternehmensführung. So bin ich bei der BKW FMB Energie AG gelandet.
Wo haben Sie dort angefangen?
Eigentlich hatte ich mich auf eine Stelle im Key Account Management beworben, aber mir fehlte die notwendige Berufserfahrung. Doch zwei Wochen später wurde mir eine Assistentenstelle bei einem Geschäftseinheitsleiter angeboten, wo ich einen guten Einblick in den Energiehandel bekam. Ohne es zu wissen, bin ich damit in einer treibenden und dynamischen Einheit der Firma gelandet, was dazu führte, dass sich mir eine Menge von Möglichkeiten boten. So bin ich nach einem Jahr ins Controlling gekommen – auch wenn mir das Thema zunächst gar nicht lag. Aber ich habe dort wahnsinnig viel gelernt. Nach einer weiteren Zwischenstation bin ich wieder zurück in den Handel gekommen und habe dort ein Ressort geleitet. Als kurz darauf eine neue Abteilung gegründet wurde, habe ich hier eine Führungsfunktion übernommen und bin somit – nur drei Jahre nach meinem Berufseinstieg – in einer oberen Kaderfunktion angekommen. Heute leite ich das Back Office der Handelsabteilung mit 40 Mitarbeitern, bei denen die Querschnitts- und Abwicklungsfunktionen für den Handel mit Energie gebündelt sind.
Was ist das Geheimnis Ihrer steilen Karriere?
Ich habe jeweils die Chancen, die sich auftaten, genutzt. Dabei musste ich mich teils von meinen ursprünglichen Steckenpferden verabschieden, aber ich habe laufend neue, spannende Gebiete kennengelernt, die mir erst einmal fremd waren oder gegen die ich sogar eine gewisse Abneigung hatte. Darüber hinaus macht es meines Erachtens keinen Sinn, einen Lebensplan zu haben, welcher vorsieht, in fünf Jahren an einer bestimmten Stelle zu stehen. Denn so läuft es vielfach in Unternehmen nicht.
Welche Tipps geben Sie Hochschulabsolventen, die ebenfalls schnell aufsteigen möchten?
Sicherlich sind Abschlusszeugnisse und Leistungen wichtig, aber immer bedeutender wird das Engagement neben der Ausbildung. Die Fähigkeiten, die man braucht, um im Berufsleben zu bestehen, werden nicht an der Uni gelehrt. Diese lernt man vielmehr bei sportlichen, kulturellen oder anderen Aktivitäten und Engagements.
Was haben Sie ausseruniversitär betrieben?
Ich habe mich bereits früh im Spitzensport, im Kunst- und Geräteturnen, engagiert und bin dann Trainer geworden. Mit 18 Jahren habe ich schon einen Club geleitet. Dabei konnte ich Erfahrungen sammeln, wie man gut mit Leuten zusammenarbeitet, wie man sie motiviert und zu Leistungen führt. Das hat mir viel für meine heutige Position als Führungskraft im Handelsbereich gebracht.
Wie funktioniert eigentlich der Handel mit Energie?
Wir kaufen und verkaufen in der Schweiz und im angrenzenden Ausland Strom. Wir handeln dabei mit Über- oder Unterkapazitäten, die wir aufgrund unserer Produktions- und Vertriebsportfolien haben. Darüber hinaus betreiben wir sogenannten Eigenhandel, indem wir Strom von anderen günstig einkaufen und teurer wieder verkaufen. Das Gleiche machen wir mit Gas, mit CO2-Zertifikaten und mit Zertifikaten für Erneuerbare Energien.
Haben Hochschulabsolventen gute Chancen, im Energiehandel zu arbeiten?
Definitiv. Unsere grösste Konkurrenz bei der Suche nach Fachkräften sind Banken und Versicherungen. Die Energiebranche hat leider teilweise noch immer ein etwas altväterliches Image – oft sind es Versorger, die sich in öffentlicher Hand befinden. Dieses Image macht uns manchmal Schwierigkeiten, genügend passende Bewerber zu finden. Ausserdem hat der Standort Bern gegenüber Zürich ein paar Nachteile, zum Beispiel beim Gehalt. Wenn die Mitarbeiter aber erst einmal bei uns angefangen haben, stellen sie meist fest, dass wir viele interessante Tätigkeiten, Perspektiven und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten haben.
Sie selber haben einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ist es nicht eigentlich sinnvoller, sich in Ihrem Bereich mit Energiefragen auszukennen?
Für meinen Bereich war mein Studium absolut sinnvoll. Aber auch Wirtschaftsinformatiker, Informatiker oder Ingenieure sind bei uns im Backoffice gut aufgehoben. Wir haben über den gesamten Handel eine breite Palette an Hochschulabschlüssen. Ich habe mir mein Know-how über die Energiewirtschaft in den vergangenen zehn Jahren im Unternehmen aufgebaut. Natürlich sollte man wissen, um was es im Energiehandel geht, aber das spezifische Wissen um Geschäftsabwicklungen ist in meinem Umfeld wichtiger. Wenn wir doch einmal Leute speziell mit Energiewissen brauchen, ist es nicht so leicht, jemanden zu finden, weil es in der Schweiz kaum dezidierte Ausbildungen in dieser Richtung gibt.
Welche Rolle spielt in Ihrem Unternehmen der Bereich Erneuerbare Energien?
In der Schweiz ist die BKW bei dem Thema führend. Wir investieren in den Bau solcher Anlagen recht viel Geld und betreiben sie auch selbst. Derzeit liegt das Geschäftsvolumen in diesem Bereich aber noch unter einem Prozent. Ein Standbein meines Bereichs ist auch der Handel mit grünen Zertifikaten, aber auch sie machen bisher nur einen sehr kleinen Teil unseres Geschäftes aus.
Was fasziniert Sie persönlich an der Energiebranche?
In der Branche tut sich derzeit viel, zum Beispiel in Sachen Liberalisierung. Bei uns gibt es viel Dynamik, zahlreiche neue Projekte werden angegangen. Durch komplexe Themen gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Die Unternehmenskultur spricht mich an, ich würde den Umgang als kollegial und offen beschreiben. Speziell die BKW bietet mit einer Firmengrösse von rund 2.800 Mitarbeitenden und internationalen Tätigkeiten Perspektiven, die einen Einstieg auch für junge Leute spannend machen.
Die Person Fritz Marti
Fritz Marti, geboren am 30. Dezember 1974, studierte Wirtschaftswissenschaften (BWL und VWL) an der Universität Bern. Im Jahr 2000 stieg er bei der Berner BKW FMB Energie AG ein. Nach mehreren Stationen im Unternehmen ist er seit 2003 Leiter Abteilung Backoffice Handel. Fritz Marti ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit betreibt er gerne Geräteturnen sowie Wintersport und hört Jazz.
Das Unternehmen BKW FMB Energie AG
Die BKW FMB Energie AG gehört mit 24 Terawattstunden Energieumsatz zu den grossen Energieunternehmen der Schweiz. Sie beschäftigt rund 2.800 Mitarbeiter, ihr Aktienkapital von 132 Millionen Schweizer Franken ist grösstenteils im Besitz des Kantons Bern (52,5 %) und der E.ON Energie AG (21 %). Die BKW liefert in rund 400 Gemeinden Strom für rund eine Million Menschen. Im Jahr 2007 versorgte sie Privatkunden und Vertriebspartner mit über 7.760 Gigawattstunden Energie. Das Unternehmen ist führend im Bereich Erneuerbare Energien: In sieben eigenen Wasserkraftwerken, im Kernkraftwerk Mühleberg bei Bern sowie in Kern- und Wasserkraftwerken von 16 Partnergesellschaften und mittels Bezugsrechten in Partner-Kernkraftwerken produziert die BKW praktisch CO2-frei Strom.
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Trotz Handicap zum Erfolg
 |
Rund zwölf Prozent der Studierenden an Schweizer Unis sind behindert oder chronisch krank. Im Studienalltag stossen sie auf zahlreiche Probleme – von der Suche nach einem Assistenten bis hin zu fehlenden Rampen auf dem Weg zum Hörsaal. Doch ihre Situation scheint sich nun endlich zu bessern.
Von: Alice Werner
Wie hoch die Zahl der Schweizer Studierenden mit Behinderung tatsächlich ist, weiss niemand ganz genau, denn die Deklaration einer Behinderung beziehungsweise einer chronischen Erkrankung bei der Online-Semestereinschreibung ist freiwillig. Im Herbstsemester 2008 haben an der Universität Zürich 133 Studierende ihre Behinderung angegeben – wie viele Betroffene sich aber nicht gemeldet haben, ist ungewiss. Eine exakte Prozentzahl zu eruieren ist auch deshalb schwer, da der Grad, ab dem eine körperliche oder psychische Beeinträchtigung als Behinderung einzustufen ist, individuell sehr unterschiedlich ausfallen kann. „Auch die Palette an chronischen Krankheiten ist sehr vielfältig“, sagt Olga Meier-Popa. Als Sprecherin der Beratungsstelle Studium und Behinderung der Universität Zürich ist Meier-Popa mit den Anliegen behinderter oder chronisch kranker Studierender betraut. „Unsere Dienste werden gut aufgenommen. In den letzten vier Monaten konnten wir 41 Studierenden helfen.“
|
Die Angebote reichen dabei von einer allgemeinen Beratung über die Vermittlung von Hilfsmitteln oder Assistenten bis hin zu einer individuellen Begleitung während des Studiums und einer Starthilfe beim Einstieg ins Berufsleben. „Wie sehr sich jemand helfen lässt, hängt von Persönlichkeit und physischer Verfassung ab“, meint Karen. „Da ist jeder anders gestrickt, das ist ja ganz normal. Jeder Mensch besitzt unterschiedliche Fähigkeiten, ist mehr oder weniger selbständig. Nur fällt dies, wenn man eine Behinderung hat, eben stärker ins Gewicht.“ Karen studiert im sechsten Semester Erziehungswissenschaften an der Uni Zürich und ist stark sehbehindert. Derzeit bereitet sie sich auf ihren Bachelor vor. Dabei hat sie zwei Möglichkeiten, sich die relevante Studienliteratur zugänglich zu machen: Entweder eine Kommilitonin spricht ihr auf Kassette, oder sie lädt sich den Stoff in elektronischer Form aus dem Internet herunter. „Eine Sprachausgabe am Computer liest mir dann den Lernstoff vor. Diese Möglichkeit ist mir lieber, da muss ich nicht ständig jemanden um einen Gefallen bitten.“ Eine wirkliche Freundin hat Karen an ihrer Hochschule noch nicht gefunden. |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Gegen die Leere im Kopf
 |

Jeder kennt es, und jeder hasst es. Wenn man sie braucht, ist sie meist nicht verfügbar – die zündende Idee. Doch man kann sie anlocken, denn jeder verfügt über ein kreatives Potenzial, und es gibt einfache Tricks, dieses Kapital zu fördern.
Von: Arne Olerth
Der Mensch unterscheidet sich vom Computer in einem wichtigen Punkt: Er kann schöpferisch denken und handeln, er kann kreativ sein. Diese Erkenntnis führt dazu, dass Kreativität im Job immer stärker gefragt wird. Aber bereits jetzt stossen viele Menschen an die Grenzen ihrer kreativen Leistungsfähigkeit. Dabei ist es ganz einfach, seinen eigenen „Kreativschatz“ zu bergen.
Ein wesentlicher Faktor für eine ausgeprägte Kreativität ist die Ernährung. Sie beeinflusst unsere Stimmung, unsere Aktivität und unsere mentale Leistungsfähigkeit. Nach Ansicht von Ernährungsexperten haben bereits geringe Mangelzustände grosse Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns – die Konzentrationsfähigkeit sinkt, und man vergisst schneller. Sogenanntes Brainfood unterstützt unsere Gehirnleistung und schützt langfristig unsere grauen Zellen. Damit ist keine Wunderdiät gemeint und auch keine Zauberpille der pharmazeutischen Industrie. Der Brainfood-Klassiker ist das Studentenfutter: getrocknete Früchte und Nüsse. US-Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die Hirnleistung bei Schülern um 30 Prozent stieg, nachdem sie einen Monat lang in den Unterrichtspausen Nüsse und Obst anstelle von Fastfood gegessen hatten.
Damit das Gehirn Höchstleistungen vollbringen kann, benötigen die Nervenzellen einen ausgeklügelten Mix aus Makro- und Mikronährstoffen, vor allem aber Energie und Wasser. Ernährungswissenschaftler empfehlen täglich mindestens zwei Liter Flüssigkeit aufzunehmen. Das Blut dickt sonst ein, und die Sauerstoffversorgung der Gehirnzellen nimmt ab. Es besteht die Gefahr von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Wasser, ungesüsste Früchte- und Kräutertees oder Fruchtsaftschorlen sollten dabei erste Wahl vor Getränkelimonaden sein. Der Powerspender fürs Gehirn ist das Kohlenhydrat Glucose. Für die Kommunikation der Gehirnzellen untereinander benötigt der Körper bestimmte Eiweisse. Auch Fette, besonders Omega-3-Fettsäuren, sind für das Funktionieren der Zellen wichtig. Vitamin- und Mineralstoffmangel setzt die Leistungsfähigkeit des Gehirns herab. Darum sollte man reichlich Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Gemüse und Obst essen und als Fett Raps- oder Walnussöl wählen. Und: Viele kleine Mahlzeiten sind besser als wenige grosse.
Banal, aber oft vergessen: Ein gesunder und ausreichender Schlaf ist für die geistige Höchstform unabdingbar. Wer früh raus muss und regelmässig vor dem Spätfilm hängen bleibt, der sollte sich nicht über schlechte Konzentrationsfähigkeit wundern. Regelmässige körperliche Aktivität steht ebenfalls auf der To-do-Liste für Kreativität. Bewegung steigert die Durchblutung und damit die Merkfähigkeit und die Funktion des Kurzzeitgedächtnisses. Schon wenige Minuten verdoppeln die Saustoffzufuhr des Gehirns. Darüber hinaus nimmt die Vernetzung der Zellen im Gehirn zu. Und so können die Zellen besser miteinander kommunizieren – ein klares Plus für die Leistungsfähigkeit des Gehirns.
Dass bei stickigem Büromief keine Geistesblitze zünden, ist wohl jedem klar. Regelmässiges Lüften erhöht die Sauerstoffkonzentration in der Luft und damit die Möglichkeit für kreative Gedanken. Kreativität braucht ausserdem Raum. An wem das schlechte Gewissen über einen Wortbruch nagt, der kann kaum kreativ werden.
Also: Weg mit dem Seelenmüll! Alles Belastende sollte man aus dem Weg räumen, dann hat der Geist Platz für kreative Gedanken. Wer rastet, der rostet. Diese Binsenweisheit gilt nicht nur für die Gelenke und den Bizeps, auch das Gehirn muss regelmässig gefordert werden, sonst erschlafft es genauso wie der untrainierte Oberarmmuskel. Für die Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl ist regelmässiges Training des Gehirns eine der drei Grundvoraussetzungen für Kreativität. Sie listet darüber hinaus assoziatives Denken und Wissen auf. Ohne geistigen Input kann es also nur wenige kreative Momente geben. Ein jeder sollte darum den natürlichen Wissensdurst stillen, sei es durch Zeitungs- und Bücherlesen, Gespräche oder Reisen. Dass ein Spaziergang durch die geschwungenen Hügel der Toskana inspirierender sein kann als der Alltag im tristen neonerleuchteten Büro, versteht sich von selbst. Solch inspirierende Momente wollen gesucht sein!
Es gibt aber auch ganz praktische Möglichkeiten, eine Idee zu entwickeln. Oberste Prämisse: Man muss das Ziel formulieren. Ohne dieses Ziel weiss das Gehirn nicht, wonach es eigentlich suchen soll. Darüber hinaus braucht es problemspezifisches Futter, also Know-how und Hintergrundwissen rund um die Fragestellung. Am besten schreibt man also das Problem als erstes auf ein Blatt Papier, denn ohne Vorbereitung kein Gedankenblitz. Als nächstes macht man einfach gar nichts. Auch wenn es sich ungewöhnlich anhört, man sollte das Problem schlicht vergessen. Das Unterbewusstsein arbeitet jetzt. Man muss Vertrauen haben und darf nicht ungeduldig werden. Die kreative Phase braucht Zeit. Notfalls kann man durch mentale Entspannungstechniken wie autogenes Training oder Yoga weiter relaxen. Meist zündet der Gedankenblitz dann in einem völlig unerwarteten Moment. Die Lösung des Problems ergibt sich zum Beispiel auf einem Spaziergang oder beim Kneipenbesuch oder kurz vor dem Aufstehen.
Dann heisst es: Die Lösung muss sofort notiert werden. Nach der Anfangseuphorie über das gelöste Problem sollte man die Lösung noch einmal in Ruhe kritisch hinterfragen. Sollte sie nicht optimal sein, so kann man seinen kreativen Prozess erneut bemühen. Keine Zauberei – mit diesen einfachen Ansätzen sollten erfolglose Ideensuchen der Vergangenheit angehören.
Webtipps:
- www.brainfit.com
- www.kreativ-sein.de
- www.philognosie.net
- www.methode.de
- Gesundheitstipps:
Sprossen sind eine unschätzbare Quelle für Mineralien und Spuren-Elementen. Sie sind reich an Kalzium und Magnesium und enthalten Eisen, Fluor, Kalium, Kupfer, Mangan, Natrium und Zink - alles, was das kreative Hirn braucht. Und das Beste ist: Sprossen lassen sich mit wenig Aufwand selbst ziehen.
Infos unter www.gesunde-sprossen.de.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 5/2009. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Internationale Traineeprogramme - Was ist das GAP?
 |

Das Global Associate Program (GAP) ist das internationale Traineeprogramm von Zurich, mit dem junge Talente gezielt auf künftige Fach- und Führungsaufgaben vorbereitet werden.
Von: Kerstin Fiselt
Weltweit werden pro Jahr rund 50-80 Associates ausgebildet. Das einwöchige Traineeprogramm umfasst sowohl eine theoretische und praktische Ausbildung im Herkunftsland der Teilnehmer als auch internationale Schulungen und einen zehnwöchigen Auslandsaufenthalt, zum Beispiel in Europa, Australien, China oder den USA. Die Teilnehmer erhalten eine Festanstellung in einem Kerngeschäftsbereich wie Underwriting, Schaden, Marketing & Vertrieb, Finanzen oder IT. Voraussetzungen für die Teilnahme am Programm sind ein erfolgreich abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Weitere Informationen zu GAP sind unter www.zurich.ch/karriere verfügbar.
Eine der ersten GAP-Teilnehmer
Anne-Catherine Grunholzer ist studierte Juristin und war Teilnehmerin des ersten GAP-Jahrgangs 2006/2007. Sie hat ihr Traineeprogramm im Geschäftsbereich Schaden absolviert. Während dieser Zeit arbeitete sie unter anderem im Bereich Komplexschaden Sach- und Haftpflicht im Center of Competence, bei der Schadenbearbeitung von Zurich Kanada in Toronto sowie im Schadencenter St. Gallen. Heute ist sie Gruppenleiterin für das Schadenmanagement im Bereich Komplexe Körperschäden.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 5 Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Internationale Traineeprogramme
 |

Wie gelingt nach dem Studium der Berufseinstieg? Traineeprogramme sind eine gute Möglichkeit, den Übergang vom Studium in den Beruf zu meistern und den Grundstein zu seiner Karriere zu legen.
Von: Kerstin Fiselt
Der Direkteinstieg ins Berufsleben kann für Hochschulabsolventen schwierig sein, weil für eine Festanstellung häufig einschlägige Erfahrung vorausgesetzt wird. Traineeprogramme sind eine interessante Alternative und richten sich an Studierende aller Fachrichtungen. Idealerweise schliesst ein Traineeprogramm direkt an den Master-Abschluss (Uni) oder den Bachelor-Abschluss (FH) an. Die Einarbeitung dauert ein bis anderthalb Jahre, in denen sich theoretische und praktische Ausbildung abwechseln, wobei der praktische Teil meist stark überwiegt.
Traineeprogramme bieten mehrere Vorteile für junge Berufseinsteiger: Das Angebot ist speziell auf Absolventen zugeschnitten, wodurch der direkte Wettbewerb zu berufserfahrenen Kandidaten entfällt. Der Berufseinstieg erfolgt schrittweise, denn die Trainees werden durch den Vorgesetzten und einen Mentor konstant betreut – auch über die Dauer des Traineeprogramms hinaus. In der Regel erhalten die Absolventen eine feste Anstellung, schliesslich sind die Unternehmen bestrebt, über die Trainees ihr künftiges Fach- und Führungspersonal zu rekrutieren und diese langfristig an die Firma zu binden. Nicht selten durchlaufen Trainees in ihrem späteren Berufsleben eine beachtliche Karriere und werden auf Führungs- und Schlüsselpositionen eingesetzt.
Internationale Ausrichtung
Viele international agierende Unternehmen integrieren zudem einen Auslandsaufenthalt in ihre Programme. So ermöglichen sie den Trainees einen Weitblick und die Förderung sozialer Kompetenzen. Ein Auslandsaufenthalt bedeutet nicht nur gute Sprachkenntnisse, sondern auch den Erwerb interkultureller Kompetenz und das Kennenlernen anderer Arbeitsweisen. Ein Beispiel für ein international ausgerichtetes Traineeprogramm ist das Global Associate Program (GAP) von Zurich Financial Services. Das einjährige Programm umfasst die theoretische und praktische Ausbildung im Herkunftsland, gemeinsame Schulungen der GAP-Teilnehmenden aus den verschiedenen Ländern sowie einen zehnwöchigen Auslandsaufenthalt. Seit Beginn des globalen Traineeprogramms 2006 haben rund 200 Personen daran teilgenommen, gut ein Drittel davon aus der Schweiz. Alle ehemaligen Schweizer GAP-Teilnehmer sind nach wie vor in verschiedenen Bereichen des Versicherungsunternehmens tätig.
Intensives Auswahlverfahren
Unternehmen, die Trainees suchen, wählen ihren Nachwuchs und vor allem die künftigen Fach- und Führungskräfte sehr sorgfältig aus. Entsprechend intensiv können die Auswahlverfahren sein. Um am GAP-Programm von Zurich teilnehmen zu können, durchlaufen die Bewerber beispielsweise folgenden Prozess: Nach der Prüfung der Bewerbungsunterlagen findet ein ausführliches Telefoninterview statt. Anschliessend müssen die Bewerber zwei Online-Tests zum analytisch-logischen Denkvermögen und zu ihrem Persönlichkeitsprofil absolvieren. Als letzte Schritte im Auswahlverfahren führen die Bewerber ein persönliches Interview mit dem künftigen Vorgesetzten sowie Vertretern der Personalabteilung und halten eine Präsentation vor dem künftigen Team. Erst dann wird definitiv entschieden, ob ein Kandidat als Trainee in die Unternehmung eintreten kann.
Die Erwartungen an Trainees sind hoch. Aufgrund ihrer Fähigkeit, sich rasch in neue Themen hineinzudenken, werden sie häufig mit der Erarbeitung von Konzepten und Strategien beauftragt. Die jungen Berufseinsteiger werden als produktive Arbeitskräfte geschätzt, die zudem flexibel einsetzbar sind und auch für einen längeren Einsatz ins Ausland entsendet werden können.
Während der Ausbildung kostet ein Trainee in der Regel mehr, als er dem Unternehmen durch seine Arbeitsleistung einbringt. Aus diesem Grund verdienen Trainees während dieser Zeit meist weniger als ein Festangestellter. Im Gegenzug ist die persönliche Betreuung ungleich höher, und die Trainees erhalten einen sehr wertvollen Wissensschub. Meist haben sie nach dem Trainingsjahr die Möglichkeit, einen anspruchsvolleren und besser bezahlten Aufgabenbereich zu übernehmen.
Traineeprogramme sind somit für alle Absolventen empfehlenswert, die leistungsbereit und engagiert sind, Freude an internationalen Kontakten haben und Wert auf eine gute Betreuung legen. Welches Programm das Richtige ist, muss individuell ausgewählt werden und ist abhängig von der persönlichen Lebensplanung, den eigenen Vorstellungen und Zielen. Je nachdem, wie mobil und flexibel ein Absolvent ist, muss er sich grundlegend zwischen einem nationalen und einem international ausgerichteten Programm entscheiden. Nahezu jedes grosse Unternehmen bietet heute Traineeprogramme an. Informationen dazu sind im Internet zu finden oder auf entsprechenden Messen und Hochschulevents.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 5. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Studentenalltag - Studium, Arbeit und Freizeit - Motivation und Prioritäten
 |

Alles unter einen Hut – nur wie?
Das Studentenleben ist vielseitig und intensiv. Verschiedenste Aufgaben und Tätigkeiten müssen unter einen Hut gebracht werden. Dabei haben viele Studenten Probleme, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie verlieren sich in zeitfressenden – wenn auch unterhaltsamen – Beschäftigungen wie facebooken oder endlosen Kaffeekränzchen mit den WG-Kollegen.
Von: Cammis*
Falls du zu den Studenten gehörst, die Probleme haben, Prioritäten zu setzen, gibt es Hilfe: Teile die Dinge, die du tun musst oder möchtest, in A-, B-, C- und D-Aufgaben ein. A steht dabei für besonders wichtig und dringend und sollte sofort bearbeitet werden. B-Aufgaben sind ebenfalls wichtig, allerdings nicht ganz so dringend. Sie sollten bei nächster Gelegenheit bearbeitet werden, denn lässt man B-Aufgaben zu lange links liegen, verwandeln sie sich irgendwann in A-Aufgaben. C-Aufgaben hingegen sind unwichtig, aber dringend. Darunter fallen sogenannte Unterstützungsaufgaben wie Klopapier kaufen und Bad putzen. Und zu guter Letzt bleiben noch die unwichtigen und nicht dringenden D-Aufgaben. Für die gilt: Direkt in den Papierkorb, denn du solltest nicht unnötigen Ballast mit dir herumschleppen. Manche D-Aufgaben wie Computerspielen oder mit den Freundinnen quatschen, machen allerdings einfach nur Spass. Ohne sie wäre das Studentenleben trist und öde, denn sie erlauben es zu entspannen und sind letztlich gut für die Motivation.
Keine Motivation?
Damit du nicht im Motivationstief versinkst, gibt es einen Trick: Erstelle eine To-Do-Liste mit all den Dingen, die du an einem Tag erledigen möchtest. Je mehr Aufgaben du als erledigt abhaken kannst, desto besser wird deine Laune. Wenn du am Ende des Tages schliesslich dein Pensum geschafft hast, kannst du mit bestem Gewissen anderen Dingen nachgehen. Doch Achtung! Am Anfang fällt es schwer, das Tagespensum richtig einzuschätzen. Solltest du dir zu viel aufgehalst haben und am Ende eines arbeitsreichen Tages immer noch eine ganze Menge Aufgaben vor dir herschieben, kann das deine Motivation beeinträchtigen.
Mit der Zeit wirst du immer besser darin, deine Aufgaben einzuteilen und Prioritäten zu setzen. Somit kannst du auch die Sonnenseiten des Studentenlebens geniessen. Denn zu einem erfolgreichen Studium gehört neben Lernen und Arbeiten auch genügend Freizeit, in der man abschalten und Energie tanken kann.
|
*Cammis sind Christa Stünzi, Anna Pirhofer, Markus Arnold, Muriel Staub, Irene Döbeli und Sebastian Elke. Sie kommen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich und studieren alle im 7. Semester an der Universität St. Gallen. Zusammen haben sie einen Ratgeber für Studierende geschrieben und geben in 13 Kapiteln wertvolle Tipps für den Studentenalltag. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Erfahrungen sammeln in der Fremde
 |

Ein Semester in Barcelona studieren oder gleich lieber über den Teich nach Sydney fliegen? Studieren in fremden Ländern ist einfacher geworden – dank der Einführung des Bologna-Systems an den Schweizer Universitäten. Die Bologna-Reform strebt eine ungehinderte Mobilität der Studierenden an. Irgendwann reizt der Gedanke, im Ausland zu studieren.
Von: Regina Wiesendanger
Unzählige Fragen tauchen auf: Was erwarte ich von meinem Aufenthalt in der Fremde? Ist die Zeit dort ein wichtiger Meilenstein für meine berufliche Karriere, oder will ich meinen persönlichen Horizont erweitern? Wo finde ich Informationen zum Auslandstudium? Tipps, wo man sich informieren kann und was bei einem Auslandsaufenthalt zu bedenken ist.
Die Bologna-Reform strebt eine europaweite Vereinheitlichung der Studiengänge an. Um Studienleistungen vergleichen zu können, wurde ein Punktesystem eingeführt, das sogenannte European Credit Transfer System (ECTS). Abgeschlossen wird das Studium neu mit dem Bachelortitel (Grundstudium) beziehungsweise mit dem Mastertitel (Hauptstudium). Ziel der Bologna-Reform ist die Mobilität der Studierenden, einzelne Semester sollen an einer ausländischen Universität besucht und als Studienleistung angerechnet werden können.
Selber organisieren oder Austauschprogramme nutzen?
Natürlich können Studenten auf eigene Faust ein Auslandsemester organisieren. Bedeutend einfacher sind jedoch die internationalen Austauschprogramme, die die Universitäten anbieten. Je nach Hochschule gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Uni Zürich beispielsweise bietet im Rahmen von organisierten Programmen im Ausland folgende Möglichkeiten an: das Erasmus-Programm, bilaterale Abkommen der Universität mit europäischen und aussereuropäischen Universitäten oder auch Regierungsstipendien (für Studierende und Postgraduierte von Schweizer Universitäten). Ein weiteres Beispiel: Die Uni Basel unterhält ebenfalls bilaterale Abkommen mit verschiedenen europäischen und aussereuropäischen Universitäten wie Prag, Vancouver oder Seoul. Basel ist ebenfalls Partner am Erasmus-Programm. Darüber hinaus bietet Basel für die USA das Mid-American Universities International Utrecht Network Exchange Program und für Australien das Australian European Network Exchange Program. Alle diese Programme unterstützen die Studenten konkret bei der Planung und Durchführung ihres Auslandaufenthaltes.
Erasmus-Programm
Die Schweiz ist als „stiller Partner“ am Erasmus-Programm beteiligt. Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) ist eines der bekanntesten Austauschprogramme europaweit. Ermöglicht wird ein Auslandstudium von einem oder zwei Semestern an einer europäischen Universität. Die Uni Zürich beispielsweise hat zur Zeit Erasmus-Verträge mit 200 Partneruniversitäten in ganz Europa. Den Studenten sollen Lehre und Forschung der Gastuniversität näher gebracht werden. Die Teilnehmer dieses Programms bleiben an ihrer Universität immatrikuliert. Der grosse Vorteil von Erasmus liegt in der einfachen Anmeldung über die eigene Universität. Die Erasmus-Koordinationsstelle an den Unis ist die erste Anlaufstelle. Sie hilft bei Fragen weiter, hält Formulare bereit usw. Weitere relevante Informationen bezüglich des Gaststudiums folgen über die eigene Uni oder die Gastuni. Darüber hinaus bilden sich an vielen Universitäten, die sich am Erasmus-Programm beteiligen, Netzwerke von Studenten, die die Gaststudenten während ihres Aufenthaltes betreuen. Das geht vom Begrüssungs-Apéro über den Campusrundgang bis hin zu organisierten Stadtrundgängen. Man kann sich einen persönlichen Mentor bestellen, einen sogenannten „Buddy“. Er ist die erste Anlaufstelle in der Fremde und unterstützt den Austauschstudenten auf Wunsch während der gesamten Zeit – eine wertvolle Hilfe, die nicht zu unterschätzen ist.
Ziele setzen
Wer ins Ausland gehen will, sollte sich überlegen, was er von dieser Zeit erwartet. Ein Aufenthalt „just for fun“? Ausflüge, Partys, die Seele baumeln lassen, einfach geniessen? Dafür fährt man besser in die Ferien. Ein organisiertes Austauschprogramm soll Sinn machen, man sollte sich Ziele setzen. Der Aufenthalt sollte das Studium voranbringen und die Studienzeit nicht unnötig verlängern. Dank der Bologna-Reform wird das Semester normalerweise angerechnet. Zur Sicherheit sollte man genau abklären, ob der gewählte Aufenthalt diese Voraussetzung erfüllt.
Auch wenn man im Ausland nichts anderes machst als in der Schweiz – nämlich leben und arbeiten –, so ist es doch etwas anderes: Wer nicht gerade nach Deutschland oder Österreich fährt, wo auch Deutsch gesprochen wird, kann seine Sprachkenntnisse anwenden und vertiefen und in der Freizeit das Land, seine Geschichte und Leute kennenlernen. Nicht zuletzt ist man aber auch persönlich gefordert: Es wird auch Momente geben, in denen nicht alles rund läuft. Man muss organisieren, improvisieren, Negatives wegstecken.
Erste Schritte
Eine allgemein gültige Anleitung, wie man sich wann und wo für ein Austauschprogramm anmelden muss, gibt es nicht. So vielfältig sind die Möglichkeiten und die Informationen, die zur Verfügung stehen. Man muss sie nur nutzen. Bei den organisierten Austauschprogrammen läuft alles über die Universität, an der der Interessent immatrikuliert bist. Massgebend ist das, was dort angeboten wird. Auf der Website der Uni finden sich in der Regel umfangreiche Infos zum Auslandstudium. Alles Wissenswerte ist dort nachzulesen: die Austauschprogramme, die zur Auswahl stehen, Voraussetzungen für ein Auslandstudium, Anmeldungsmodalitäten, Termine, Stipendien usw. Ebenso gibt es Angaben zur Beratungsstelle, mit der man Kontakt aufnehmen kann und die sämtliche Fragen beantwortet. Teilweise finden sich sogar Erfahrungsberichte von Studenten, für die das Auslandsemester bereits Vergangenheit bedeutet – sehr interessant zu lesen und unbedingt empfehlenswert als erster Eindruck zu Land und Leuten.
Damit man nicht im Flieger sitzt, während zu Hause noch die Herdplatte heiß ist, sollte man eine Checkliste erstellen über das, was neben den Uni-Formalitäten alles zu regeln ist: Ein- und Ausreiseformalitäten des Landes, An- und Abmeldung, Krankenkasse, Unfallversicherung usw.
Sprachkenntnisse
Über das Auslandstudium sollte man sich keine falschen Erwartungen machen: Die Reise ist kein Sprachaufenthalt, bei dem man in aller Ruhe die Sprache erlernen kann. Hilfreich ist es deshalb, schon vor der Planung des Aufenthaltes einen Sprachtest zu machen. In den Vorlesungen zu sitzen und nicht zu verstehen, was der Professor doziert, kann ganz schön frustrierend sein. Die Studenten sollten zumindest den Vorlesungen folgen können. Gute Grundkenntnisse der Sprache des Gastlandes (oder der Unterrichtssprache) werden vorausgesetzt. Sicher wird darüber hinaus jeder seine Sprachfertigkeiten verbessern können.
Bei aller Arbeit im Vorfeld: Ein Auslandsemester ist immer ein Pluspunkt in der beruflichen Laufbahn. Es zeugt von Offenheit, Engagement, Selbstständigkeit und Flexibilität. Und nicht zuletzt bleibt all das, was man persönlich erlebt und kennenlernt: Land und Leute, kleine und grosse Geschichten, Begegnungen, die man noch lange in Erinnerung behält.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 4 - 2008. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Online-Jobbörsen
 |

Egal ob man in den Semesterferien ein bisschen Geld verdienen oder ein Praktikum absolvieren möchte, ob man eine langfristige Nebenbeschäftigung oder gar den ultimativen Traumjob nach dem Uni-Abschluss sucht – man kommt um sie nicht mehr herum: die Online-Stellenbörsen.
Von: Alice Werner
Konkurrenzlos stehen sie an der Spitze des Stellenmarkt-Universums; ihre papiernen Kollegen der Tageszeitungen haben sie längst abgehängt. Nur wer eine wissenschaftliche Karriere an der Uni anstrebt oder sich auf eine Kaderstelle in einem grossen Unternehmen bewerben will, sollte regelmässig die NZZ, die FAZ und DIE ZEIT nach Angeboten durchforsten. Alle anderen Jobsucher können sich getrost in die virtuellen Welten der Stellenportale stürzen, denn die Stärken der Internet-Recherche sind offensichtlich: Die meisten Jobseiten werden ständig aktualisiert, neue Angebote können 24 Stunden täglich eingestellt werden.
Der Online-Stellenmarkt funktioniert sehr schnell, und wer wirklich einen Arbeitsplatz oder eine Beschäftigung sucht und auch finden möchte, der sollte relevante Jobseiten mehrmals täglich auf neue Angebote hin überprüfen und dann auch entsprechend schnell reagieren. Ein gut erstelltes PDF-Dokument aus (höchstens zweiseitigem) Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und eventuell Arbeitsproben ist dafür absolute Voraussetzung. Zusammen mit einem überzeugenden Anschreiben, das über persönliche Motivation und individuelles Interesse an der ausgeschriebenen Stelle informiert, kann die Bewerbung dann schnell losgeschickt werden.
Suche optimieren
Als Promotionsgirl auf einem Event arbeiten, bei einem wissenschaftlichen Versuch an der eigenen Universität mitmachen, Trainee bei einem grossen Energiekonzern werden oder doch lieber ein akademisches Graduate Programme absolvieren? Oder mal etwas ganz anderes ausprobieren und bei der Aufzucht von Insekten im Zoo mithelfen? Wer sich nicht im riesigen Angebotsmarkt der Online-Stellenbörsen und Jobsuchmaschinen verlieren möchte, der sollte für sich einige klare Suchregeln aufstellen. Da zudem die Qualität der verschiedenen Jobbörsen schwankt, empfiehlt es sich, die entsprechenden Websites zu klassifizieren, also in relevant und unbrauchbar einzuteilen.
Alternativen im Auge behalten
Auch wenn heute viele Jobs über Online-Stellenbörsen vergeben werden - es gibt auch andere erfolgreiche Wege, die zu einem Arbeitsplatz führen. Wer nicht so recht weiss, auf welches Jobprofil er passt, kann sich auch überlegen, bei welchem speziellen Unternehmen er gerne arbeiten würde. Ein Blick auf die jeweilige Homepage der Firma lohnt in jedem Fall. Vielleicht wird eine interessante Position neu besetzt, an die man gar nicht gedacht hat. Oder die Stelle wird überhaupt nicht auf Jobseiten ausgeschrieben. Diese beliebte Methode vor allem grosser Firmen schränkt die Bewerberzahl von vornherein ein und stiegert das individuelle Quentchen Glück, das immer eine Rolle spielt. Es spricht auch nichts dagegen, Initiativbewerbungen zu verschicken. Entweder in Anlehnung an eine angebotene Stelle, auf die man sich zum Beispiel aufgrund mangelnder Berufserfahrung nicht bewerben kann, oder als wirklicher Versuch «ins Blaue hinein». Denn in vielen Branchen, etwa im gesamten Kulturbereich, werden freie Stellen, Praktikums- und Volontariatsplätze nicht offiziell bekanntgegeben, da sowieso laufend Initiativbewerbungen eingehen. Wer diese initiative Bewerbungsmethode ausser Acht lässt, bleibt in vielen Fällen aussen vor.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 4 - 2008. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Unbegrenzte Möglichkeiten für Ingenieure
 |

Ingenieure und ihre Karrieremöglichkeiten im Ausland nach dem Studium
Von: Christoph Deuel
In Zeiten der Konjunktur, wie wir sie gerade in vollem Gange erleben dürfen, rückt das Wachstum in der Prioritätenliste potenter Firmen an oberste Stelle. Unternehmungen müssen ihre Position stärken und ausbauen, Qualität sichern und Innovationen lancieren. All diese Aufgaben erfordern gut ausgebildete Ingenieure, hoch motiviert, leistungsfähig und auf dem neusten Stand der Forschung. Die Nachfrage ist gross, und die Hochschulabgänger in ungenügender Zahl, um die gebotenen Arbeitsplätze zu besetzen. Mit immer attraktiveren Angeboten wird gefochten um die heissbegehrten Maschinenund Bauingenieure, Informatiker, Materialwissenschaftler, Verfahrens-, Elektro-, Biomedizinal- und Informationstechniker.
Hierzulande gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die Arbeit im Ausland anbieten. Dabei können wertvolle Erfahrungen und Softskills gesammelt werden, wobei die Fremdsprache ein weiterer Motivator sein kann. Die ABB kennt so genannte Trainee-Programme. Während ca. 15 Monaten absolviert ein Trainee ein individuelles, auf ihn zugeschnittenes Programm, das er nach seinen Wünschen und Interessen gestalten kann. Die Stationen sind folgendermassen gegliedert: Die beiden ersten Stationen à sechs Monate werden in der Schweiz absolviert. So können unterschiedliche Abteilungen und Aufgabenbereiche kennen gelernt werden. Im Anschluss wird der Trainee für mindestens drei Monate im Ausland tätig sein, um seinen kulturellen und sprachlichen Horizont zu erweitern.
In der Schweiz ist der Markt gierig und die Einstiegsgehälter hoch. Doch das Ausland kennt den gleichen Fachkräftemangel und holt auf. An vorderster Front kämpft unser Nachbarland Deutschland um die Abgänger führender technischer Hochschulen. So spricht Ex-BMW-Chef Joachim Milberg gegenüber dem Handelsblatt von bereits zwischen 20’000 und 40’000 fehlenden Ingenieuren deutschlandweit. Die Löhne, welche die deutsche Industrie inzwischen bezahlt, sind längst mit schweizerischen Verhältnissen vergleichbar. Vor allem in der Fahrzeug- und Maschinenbaubranche verzeichnet der Verein Deutscher Inge-nieure beachtliche Lücken. Karrierechancen scheinen real und die Sicherheit der Arbeitsplätze hoch.
Neben Deutschland buhlen auch die anderen mitteleuropäischen Länder um die Gunst hiesiger Ingenieure. Dank der bilateralen Abkommen stehen keine Grenzen im Weg, die attraktiven Angebote aus der nahen EU anzunehmen. Norditalien rekrutiert schon seit Jahren routiniert Akademiker aus dem Ausland, und Frankreich fragt primär nach Verkaufs- und Vertriebspersonal mit technischem Hintergrund. Grossbritanniens Stellenmarkt ist staatlich organisiert und will mit deutschsprachigem Personal nach Deutschland expandieren. Des Weiteren existieren private Stellenagenturen, die berufsgruppenspezifisch hinter qualifizierten Köpfen herjagen. Der niederländische Arbeitsmarkt hat einen wesentlich besseren Ruf als der deutsche und ist unserem sehr ähnlich. Neben Headhunters und Stellenvermittlungsagenturen werden freie Arbeitsplätze in Zeitungen, dem Internet und bei öffentlichen Arbeitsämtern publiziert. Grosse Firmen haben Standbeine in verschiedensten Nationen und ermöglichen so auch Erfahrungen in der ganzen Welt. Generell ist es von Vorteil, die Landessprache der gewünschten Destination zu beherrschen und sich mit dem präferierten Arbeitgeber über den Internetauftritt oder anderen, Profilquellen vertraut zu machen, um sich optimal ins Unternehmen einzugliedern.
Viele junge Ingenieure zieht es dennoch weiter in die Ferne. Als Forschungsbasis und Geburtsstätte führender Konzerne bieten die USA eine hervorragende Alternative, Netzwerke zu knüpfen, Zugang zu einem riesigen Fundus technologischen und wirtschaftlichen Know-hows zu erhalten und reale Karrierechancen zu haben. Ausserdem locken in Anbetracht der tiefen Steuern ein angemessener Lohn und internationale Teams bestens qualifizierter Fachkräfte, an die allerdings auch hohe Anforderungen gestellt werden. Diese sind neben ausgezeichneten Fremdsprachenkenntnissen und ständiger Lernbereitschaft vor allem eine hohe Flexibilität, bezogen auf die Mobilität und unentgeltlichen Überstunden. Nur so besteht Aussicht auf einen Job in dem vor allem durch Spontanbewerbungen dominierten Stellenmarkt. Zusätzlich ist zu beachten, dass schweizerische Hochschulabschlüsse nicht anerkannt und in der Regel unterbewertet sind.
Klimawandel verstärkt den Abolventenbedarf
„Es gibt viel zu tun.“ meint Accenture und spricht dabei den Absolventen genauso aus dem Herzen, wie sämtlichen Partizipanten der gegenwärtigen Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Gesundheitstrends. Diese Strömungen sind in Verbindung mit der begünstigten Wirtschaftslage eine bestmögliche Grundlage ansprechende Stellen im nachhaltigen und innovativen Technologiebereich zu finden. Nur die effiziente Beschäftigung qualifizierter naturwissenschaftlicher Spezialisten kann uns vor der befürchteten Klimakatastrophe bewahren. Dr. Manfred Thumann, Mitglied der Axpo Konzernleitung, präzisiert: „Erdrutsche, Überschwemmungen, steigende Wasserspiegel usw. sind bei allen Schadensberechnungen des Klimawandels ganz weit vorne mit dabei, und wenn wir mit aller Macht etwas dagegen unternehmen wollen, braucht es Ingenieure, die wirksame Massnahmen sozialverträglich umsetzen können.”
Zweifellos wird der Klimawandel enorme Anstrengungen brauchen, um dessen Folgen zu beherrschen oder zumindest eindämmen zu können. Je mehr junge, tatkräftige und verantwortungsvolle Studentinnen und Studenten sich um diese Aufgaben kümmern, umso mehr wird es uns gelingen, die negativen Folgen zu verringern und an besseren Alternativen zu arbeiten.“
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 2
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Karriere-Chance Kanada
 |

Auslandserfahrung ist auf dem heutigen Arbeitsmarkt sehr gefragt. Viele Studierende möchten im Ausland Berufserfahrung sammeln und gleichzeitig ihre Fremdsprachenkenntnisse vertiefen. Und wenn man Kanada-Fan ist, wohin dann sonst?
Von: Ana Vega
Eines der beliebtesten Länder für ein Auslandspraktikum bei Schweizer Studenten ist Kanada. Leider ist es nicht einfach, auf legale Art und Weise in Kanada zu arbeiten. Es ist nicht erlaubt, eine Stelle anzunehmen, ohne eine vorherige Bewilligung von den kanadischen Einreisebehörden zu erhalten. Deshalb haben Kanada und die Schweiz ein Stagiaires-Abkommen abgeschhlossen. Ein ähnliches Abkommen besteht auch mit 26 weiteren Staaten, z.B. Australien, Südafrika und den Vereinigten Staaten.
|
Stagiaires heisst kurzgefasst „Arbeiten und Reisen“. Die Stagiaires (Praktikanten) sind schweizerische Staatsangehörige, die im Ausland, im gelernten Beruf arbeiten möchten. Nicht nur junge Berufsleute nach ihrem Lehrabschluss, sondern auch StudentInnen haben seit Februar 2007 die Möglichkeit, ein Arbeitsvisum für Kanada im erlernten Beruf respektive Studiengebiet zu beantragen.
Allgemeine Bedingungen - Alter zwischen 18 und 35 Jahren zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. - Schweizer StaatsbürgerIn, bei Gesuchstellung in der Schweiz wohnhaft. - Schweizer Reisepass, gültig während der ganzen Aufenthaltsdauer. - Nachweis einer Krankenversicherung, die Arzt- und Spitalkosten für die Dauer des Aufenthaltes decken. (Es wird dringend empfohlen, das Bewilligungsschreiben der Botschaft von Kanada abzuwarten, bevor eine Versicherung abgeschlossen wird). - Es können höchstens zwei Arbeitsbewilligungen im Rahmen dieses Abkommens beantragt werden. Die Aufenthalte dürfen nicht unmittelbar folgen und eine Totaldauer von 18 Monaten nicht überschreiten. Ein neues Gesuch muss in der Schweiz gestellt werden.
Die zwei Stagiairesprogramme: 2. Studienbegleitendes Praktikum:
Anmerkung - Es ist wichtig zu wissen, dass für zeitlich befristete Arbeitsaufenthalte oder Praktika in Kanada eine Arbeitserlaubnis erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn die Tätigkeit nur für einen kurzen Zeitraum und/oder unbezahlt erfolgt. - Die kanadische Botschaft in der Schweiz verfügt über keinerlei Informationen zu Stellenangeboten, Praktika und potenziellen Arbeitgebern. Auch können keine Listen von Versicherungen und Unterkünften von dort bezogen werden. Es gibt aber zahlreiche Agenturen und Internetseiten welche diese Informationen liefern. (z.B. www.spracherlebnis.ch) - Das Stagiairesabkommen dient nicht dazu, Personen einen Arbeitsaufenthalt zu gewähren, die auf eine Bewilligung als Permanent Resident warten. - Es empfiehlt sich die aktualisierten Informationen zu den Bearbeitungsgebühren auf der Internetseite der Botschaft von Kanada zu beachten, bevor man den Antrag stellt.
Antragsformulare und detaillierte Informationen finden Sie im Internet unter: www.amb-canada.fr/visas
Fragen und Antworten
Warum sollte man ein Praktikum machen?
Wie finanziert man ein Praktikum?
Wie bewirbt man sich um ein Praktikum in Kanada?
Wie lange sollte ein Praktikum dauern?
Weitere Informationen
Der SCROGGIN-Buchtipp zum Thema:
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 2 Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Master of Law - Interview mit Dr. Markus Lotz
 |

Dr. Markus Lotz studiert an der University of California in Berkeley.
Von: Jennifer Wroblewsky
Warum haben Sie sich für ein LL.M-Studium entschieden?
Nach dem Abschluss meines LL.M-Studiums möchte ich in einer internationalen Wirtschaftssozietät arbeiten. Dafür sind verhandlungssichere Englischkenntnisse unerlässlich. Ausserdem findet die Arbeit oftmals in Teams mit anglo-amerikanischen Rechtsanwälten statt, so dass Kenntnisse der verschiedenen Kulturen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sehr hilfreich sein können.
Warum in den USA?
Die USA sind die führende Wirtschaftsmacht, ihre Universitäten geniessen Weltruf, und das amerikanische Recht beeinflusst die Schweizer Praxis immer mehr.
Warum haben Sie sich für diese Law School entschieden?
Für mich ist die Wahl auf die University of California at Berkeley (Boalt Hall) gefallen, weil die Universität als beste staatliche Universität der Vereinigten Staaten ein weltweit hohes Ansehen geniesst und ein kleines LL.M-Programm aufweist – circa 70 Studenten. Zudem sind die Studienbedingungen optimal: Auf der einen Seite ist Berkeley eine relativ kleine Universitätsstadt, auf der anderen Seite ist San Francisco zur Zerstreuung in unmittelbarer Nähe.
Welches Fazit ziehen Sie bis jetzt aus dem Programm?
Es stellt für mich eine ungemeine Bereicherung sowohl in akademischer als auch persönlicher Hinsicht dar. Das Studium ist akademisch auf sehr hohem Niveau und gibt einen optimalen Einblick in die angloamerikanische Rechtskultur.
Wie ist das Leben in den USA?
Positiv hervorzuheben ist die – oftmals als Oberflächlichkeit verschriene – Freundlichkeit der Bewohner in Kalifornien und speziell in San Francisco und Berkeley und deren Offenheit und Toleranz gegenüber Menschen aus aller Welt. Als negativen Aspekt kann man anführen, dass die Kluft zwischen reichen und armen Bevölkerungsschichten immer grösser wird und sich dies auch im alltäglichen Leben zeigt. San Francisco beispielsweise hat ein grosses Problem mit obdachlosen Menschen.
Bleibt neben dem Studium genug Zeit, um das Land kennenzulernen?
Soweit es das Studium zulässt, versuche ich so oft wie möglich San Francisco und die Bay Area zu erkunden. Darüber hinaus bin ich mit Freunden nach Los Angeles, Las Vegas, New York und Hawaii gereist.
Was nimmt man ausser dem Titel aus dem USA-Aufenthalt mit?
Das Bewusstsein, die Sprache sehr gut zu beherrschen, Freunde aus aller Welt gefunden zu haben und einen „internationalen Touch“ bekommen zu haben, der einen hoffentlich nicht wieder loslässt.
Was sollte jemand, der sich für ein LL.M-Studium in den USA bewerben möchte, auf jeden Fall wissen?
Nicht unterschätzt werden darf der zeitliche Aufwand, der sich hinter einer erfolgreichen LL.M-Bewerbung verbirgt. Zwei Jahre sollten für die Vorbereitung eingeplant werden.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 2 und wurde zur Verfügung gestellt von karriereführer recht. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Master of Law
 |

Die Ausbildung an U.S. Law Schools zum Master of Laws (LL.M) geniesst einen sehr guten Ruf und eröffnet neue berufliche Perspektiven. So ist sie besonders in internationalen Kanzleien und Unternehmen gern gesehen.
Denn ein LL.M-Studium in den USA fördert nicht nur die Englisch-Kenntnisse, sondern gewährt vor allem einen Einblick in die Denk- und Argumentationsweise des amerikanischen Rechts, das die internationale Wirtschaftsordnung inzwischen massgeblich bestimmt.
Von: Jennifer Wroblewsky
Für Dr. Daniel Biene, einer der Autoren des Ratgebers „USA-Masterstudium für Juristen“, gab es keine Alternative: Er wollte den „Master of Laws“ auf jeden Fall in den USA erwerben. An der Cardozo Law School in New York absolvierte er ein LL.M-Programm, dessen Schwerpunkt im Medienbereich lag. „Vom amerikanischen Recht sind heute fast alle internationalen Verträge im Wirtschaftsbereich beeinflusst“, so der 31-Jährige. Darüber hinaus waren dem Juristen die Erfahrungen in einer Kultur wichtig, in der Englisch nicht nur die Unterrichts-, sondern auch die Alltagssprache ist.
Das Studium an einer amerikanischen Law School setzt die erfolgreiche Teilnahme am Sprachtest TOEFL (www.toefl.org) voraus. „Für die Examensnote gibt es keine festen Vorgaben“, sagt Biene. „Die Law Schools achten zwar auf die Note, allerdings können weniger gute Noten unter Umständen durch einen besonders attraktiven Lebenslauf oder ungewöhnliche Erfahrungen kompensiert werden.“
Zurzeit bieten etwa 80 U.S. Law Schools Master-Programme an. Das in den USA so wichtige Uni-Ranking sollte man bei der Auswahl eines LL.M-Programms jedoch nur eingeschränkt zu Rate ziehen: „Die meisten Rankings orientieren sich an dem normalen amerikanischen Studium – wie gut oder schlecht das LL.M-Programm an der betreffenden Law School ist, wird nicht erfasst“, sagt Biene. Vielmehr komme es darauf an, dass man sich an seiner Wunsch-Uni wohlfühlt. „Man sollte sich zum Beispiel fragen, ob man lieber in der Grossstadt oder auf dem Land leben möchte.“
Ob die Studenten sich wohlfühlen, hängt sicher auch mit der jeweiligen Kultur zusammen, die an den verschiedenen Law Schools herrscht. Die Spannbreite reicht von den eher traditionellen oder konservativen Schulen, wie etwa Columbia oder Fordham, bis hin zu solchen, in denen noch der Geist der Hippie-Bewegung weht, zum Beispiel Berkeley oder Madison-Wisconsin.
„An der Cardozo Law School in New York sind Kultur und Atmosphäre sehr durch die starke Ausrichtung auf Media, Art and Entertainment Law geprägt. Das sorgt natürlich für eine andere Grundstimmung als bei einer Law School, die ihren Schwerpunkt im Gesellschaftsrecht hat“, so Biene. Wer sich erst einmal anhand eines Rankings einen Überblick über die verschiedenen Programme verschaffen möchte, dem empfiehlt er den US News and World Report, der das bedeutendste Ranking erstellt (www.usnews.com).
In den USA gibt es inzwischen viele Spezialprogramme, die sich mit einzelnen Ausschnitten der Rechtslandschaft beschäftigen. Grundsätzlich kommt es nicht auf die Spezialisierung an, da potenzielle Arbeitgeber einen LL.M vor allem als Nachweis perfekter Fremdsprachenkenntnisse betrachten.
Manchmal kann eine Qualifizierung in einem Spezialgebiet jedoch durchaus sinnvoll sein. Bienes LL.M war stark auf den Medienbereich fokussiert. Das hat sich ausgezahlt: Heute ist er Referent des Vorstandsvorsitzenden der Ganske Verlagsgruppe in Hamburg.
Es sei wichtig zu überlegen, in welche fachliche Richtung man gehen möchte, so Biene. Eine Auflistung der verschiedenen Programme von Admiralty Affairs bis Urban Studies findet sich auf der Website der „American Bar Association“ (www.abanet.org). Wer sich für ein spezielles Fachgebiet interessiert, dem rät Biene, sich frühzeitig in der Szene umzuhören: „Gute Quellen sind neben Gastprofessoren vor allem Praktiker in den entsprechenden Rechtsgebieten. Auch in einschlägigen Fachaufsätzen wird immer wieder auf Koryphäen und die Law Journals bestimmter Schulen verwiesen.“
Wegen der hohen Studiengebühren ist ein Studium ohne Stipendium nicht so einfach zu realisieren. Die meisten Law Schools liegen mit ihren Studiengebühren für Masterprogramme bei etwa 35’000 US-Dollar (circa 44’100 CHF). Hinzu kommen die Lebenshaltungskosten, die deutlich vom jeweiligen Ziel abhängen. „In New York zum Beispiel muss man mit mindestens 2'000 Dollar (etwa 2'500 CHF) pro Monat rechnen, in einem kleineren Dorf kommt ein Student schon mit 500 Dollar (etwa 630 CHF) über die Runden“, sagt der LL.M-Experte.
Realistische Chancen auf ein Stipendium hat, wer sehr gute Noten mitbringt und sich sehr lange vorher für ein Stipendium und bei der Wunsch-Law School bewirbt. „Studierende sollten sich mindestens zwei Jahre vor dem gewünschten Studienstart gedanklich mit dem Thema auseinandersetzen und erste Weichen stellen“, empfiehlt Biene.
Der Master of Laws wird vor allem bei den international operierenden Kanzleien und Unternehmen als besonders wertvolle Zusatzqualifikation angesehen, da die gesammelten Auslandserfahrungen die Arbeit im internationalen Umfeld erleichtern. Der Titel wird zwar nicht immer zusätzlich vergütet, bietet aber bessere berufliche Perspektiven: „Vor dem Hintergrund amortisieren sich die exorbitanten Kosten des Studiums in den USA wieder“, so der Medienrechtler. Letztendlich ist für einen Arbeitgeber nicht nur der blosse Titel interessant, sondern das, was dahinter steckt: hervorragende Englischkenntnisse, interkulturelle Kompetenz, Lebenserfahrung, persönliche Reife, internationale Rechtskenntnisse, Flexibilität, weltweite Kontakte und Planungsgeschick. Letzteres beweist jeder, der ein Studium in den USA selbstständig organisiert hat.
|
Der Artikel erschien im 'SCROGGIN-career' Ausgabe Nummer 2 und wurde zur Verfügung gestellt von karriereführer recht. Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Prüfungsangst - Nein, Danke!
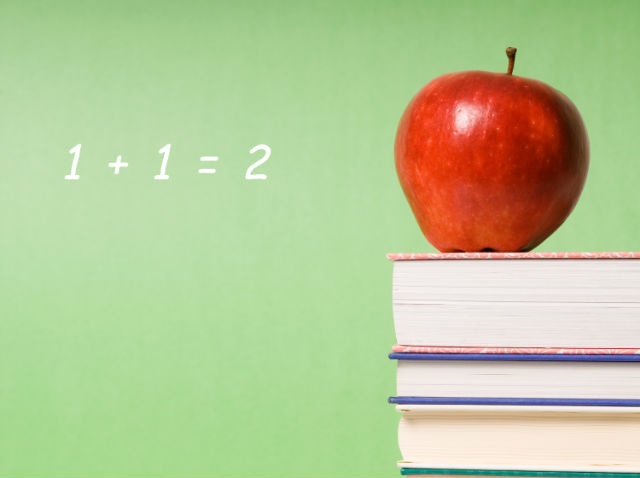 |
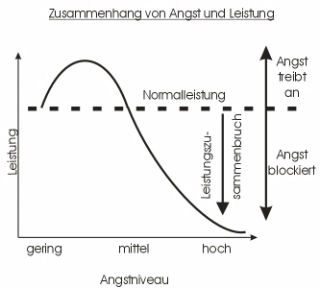
Wer hat sie nicht, die Angst vor der Prüfung? Während die einen scheinbar gelassen jede Prüfungssituation meistern, steigt für andere die Angst bis zur Unerträglichkeit. Was hilft? Erstens: den Blickwinkel auf die Prüfungssituation zu verändern, zweitens: sich körperlich optimal vorzubereiten.
Von: Dr. Hemma Fuchs
Prüfungsangst ist eine Form von Stress. Ein gewisses Mass an Stress ist notwendig, damit wir Top-Leistung erbringen können. Übersteigt der Stress- beziehungsweise Angstlevel das optimale Mass, kann es zu einer Blockade, dem sogenannten Black-out, kommen und wir sind nicht mehr fähig, unsere Leistung zu erbringen.
Eine Prüfung ist eine körperliche Höchstleistung, auch wenn es von aussen nicht danach aussieht. In unserem Körper laufen hochkomplexe Prozesse ab, die nicht nur unser Gehirn betreffen. Daher ist es wichtig, dass du vor jeder Prüfung deinen Körper trainierst und vorbereitest. Dazu gehört nicht nur, den Stoff erarbeitet zu haben, sondern auch deinen Körper fit zu halten: durch gesunde Ernährung, viel Bewegung und Entspannung.
Das klingt nach der ewig gleichen Leier – aber es stimmt nun mal. Stress ist Teil unseres natürlichen Überlebenstriebs. Wenn wir eine Gefahr als solche erkennen, schüttet unser Körper Hormone aus, die den Körper für Flucht oder Verteidigung vorbereiten. Das heisst, das rationale Denken wird ausgeschaltet, weil instinktive Handlungen schneller ablaufen, und nicht unbedingt lebensnotwendige Körperfunktionen, wie die Verdauung oder der Sexualtrieb, werden eingeschränkt.
Wie bereitest du dich also optimal auf die Prüfung vor?
1. Geistig
Unternehmerisches Denken ist gefragt: Wie viel Risiko will ich eingehen? Wie gut sind meine Informationsquellen? Ist der Stoff einmal abgegrenzt und die Lernstrategie festgelegt, hilft ein Lernplan beim Zeitmanagement. Einige lernen lieber auf den letzten Drücker, andere bereiten sich schon früh vor. Wichtig ist, dass du dir realistische Lernziele steckst und nicht vergisst, Pausen einzuplanen.
2. Körperlich
In Stresssituationen wird unser Körper mit viel Energie in Form von Zucker versorgt. Damit wir im Notfall davonlaufen können, wird der Zucker vor allem in die Muskeln gepumpt. Wenn die Muskulatur nicht gebraucht wird, bleibt der Zucker unverbraucht liegen. Bewegung zwischendurch, am besten im Freien, hält nicht nur den Körper fit, sondern durchlüftet auch den Geist.
Weil der Körper aber Energie braucht, solltest du viel Wasser trinken und einmal mehr Gemüse und Salat ins Studentenmenü einbauen. Vorsicht bei Energy-Drinks und Kaffee: Kurzfristig regen sie den Körper zwar an, aber wenn der Körper eine Erholungsphase braucht, sinkt längerfristig das Leistungsniveau. Also Energy-Drinks lieber nur gezielt am Prüfungstag einsetzen. Und wenn du merkst, dass dein Körper eine Pause braucht, solltest du ruhig auch einmal nichts tun oder aktiv entspannen.
3. Mental
Mantra Nummer 1: «Ich schaffe die Prüfung.» Noch bevor du ins Studium gestartet bist, hast du zahlreiche Prüfungssituationen erlebt und erfolgreich gemeistert. Die nächste Prüfung wird nicht anders sein! Wenn du den Stoff erarbeitet und dich körperlich fit gehalten hast, kannst du dich auf den Tag der Prüfung sogar freuen. Schliesslich darfst du beweisen, was du kannst, und danach ist es vorbei, und du hast allen Grund zu feiern. Es hilft also, sich schon frühzeitig zu sagen: «Ich freu mich auf die Prüfung.» Anfangs klingt das zwar noch komisch, aber mit der Zeit funktioniert es. Ausprobieren ist hier die Devise.
Der Aufwand lohnt sich. Das Erfolgserlebnis der bestandenen Prüfung darf ausgekostet werden. Und die eine oder andere Lernstrategie hilft dir später auch im Berufsleben weiter.
Tipps fürs Lernen:
- Lege dir einen Lernplan zurecht.
- Trinke viel Wasser oder ungezuckerten (Früchte-)Tee.
- Gönn dir regelmässig Pausen.
- Geh zwischendurch mal an die frische Luft.
- Bewege dich in den Pausen.
- Belohne dich für einen Lernerfolg.
- Freu dich auf die Prüfung. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst!
|
Link zu anderen Stories |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben


 Wenn Du eine andere Person auf www.scroggin.info einlädst, weden Dir "150" Punkte auf Deinem Punktekonto gutgeschrieben!
Wenn Du eine andere Person auf www.scroggin.info einlädst, weden Dir "150" Punkte auf Deinem Punktekonto gutgeschrieben!