pressetext
Laptops sind keine ideale Lernhilfe

Handschriftliche Notizen fördern Verständnis eher
Princeton (pte011/25.04.2014/13:33) - Für immer mehr Studenten ist das Notebook ein Lernbegleiter, auf dem sie auch ihre Notizen währen Vorlesungen machen. Doch das ist einer aktuellen Studie zufolge gar nicht so gut. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Laptops auch bei korrekter Nutzung - also nicht zum Einkaufen auf Amazon während des Unterrichts - dennoch die akademische Leistung schmälern können", so Pam Mueller, Psychologin an der Princeton University http://princeton.edu . Um Konzepte wirklich zu begreifen und langfristig zu behalten, ist es immer noch besser, sie wirklich zu Papier zu bringen.
Wissen gehört auf Papier
Mobile Computer halten immer stärker in Hörsälen Einzug, was bisher vor allem aufgrund der potenziellen Ablenkung - durch Spiele, Shopping oder überschwänglichen Online-Medienkonsum - auf Kritik gestoßen ist. Doch die in Psychological Science http://pss.sagepub.com veröffentlichte Studie zeigt ein viel grundlegenderes Problem. Digitale Notizen scheinen nicht das ideale Mittel, wenn es darum geht, wirklich inhaltliche Konzepte zu verstehen, statt nur einfach Fakten zu behalten. Das hat ein Experiment mit 65 Studenten gezeigt, die sich Notizen zu ausgewählten TED Talks http://ted.com/talks entweder auf einem Laptop oder auf einem Notizblock machen durften.
Nach den Vorträgen, die nicht unbedingt alltägliche Informationen enthalten, mussten die Probanden Ablenkungen über sich ergehen lassen, darunter eine schwierige Gedächtnisübung. 30 Minuten nach dem eigentlichen Vortrag mussten die Studenten dann Fragen zum jeweiligen TED Talk beantworten. Ging es einfach nur um Fakten, war es egal, wie die Probanden mitgeschrieben hatten. Bei konzeptionellen Fragen ("Wie unterschieden sich Japan und Schweden in ihrem Zugang zu Gleichberechtigung in der Gesellschaft?") schnitten die Laptop-Nutzer hingegen deutlich schlechter ab.
Häufig Sinnloser Wortlaut
Die digitalen Notizen waren umfangreicher und haben Vorträge eher wörtlich wiedergegeben. Ersteres scheint zwar von Vorteil, Letzteres dagegen hinderlich für den Lernerfolg. Die Forscher vermuten, dass handschriftlich Mitschreibende Information direkt vorverarbeiten und daher Wichtigeres notieren. Daher kam etwas überraschend, dass Notebook-Nutzer auch dann merklich schlechter abschnitten, wenn sie explizit ermuntert wurden, wörtliches Mitschreiben zu unterlassen. Bei Tests eine Woche nach dem Vortrag hatten Studenten mit Notizen auf Papier erneut die Nase vorn. Wieder zeigte sich, dass wörtliche Mitschriften konzeptionellem Verständnis nicht dienlich scheinen.
"Ich glaube nicht, dass wir Menschen in Massen dazu bekommen, zum Notizblock zurückzukehren", sagt Mueller. Doch gibt es einige neue Stylus-Technologien, die vielleicht eher einen sinnvollen Zugang zu digitalen gespeicherten Notizen ermöglichen. Denn solche Geräte hätten auch den Vorteil "gezwungen zu sein, eingehende Information zu verarbeiten, statt sie nur gedankenlos aufzuschreiben". Jedenfalls sollten sich die Menschen bewusst vor Augen führen, wie sie Notizen machen - sowohl mit Blick auf das Medium als auch die Strategie.
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Auslandskarriere attraktiv wie nie
 |
Deutschland belegt fünften Platz als beliebtestes Zielland
Düsseldorf (pte001/18.04.2012/06:00) - Nie waren mehr Menschen offen für die Karriere-Option Ausland. 68 Prozent der internationalen Fachkräfte sind gewillt, fern der Heimat zu arbeiten - ein Anstieg von vier Prozent gegenüber 2009, wie eine Studie der Online-Jobbörse StepStone http://stepstone.de in Kooperation mit "The Network" und der Intelligence Group zeigt. Insgesamt wurden mehr als 162.000 Fach- und Führungskräfte aus 66 Ländern befragt. "Der Anstieg erklärt sich unter anderem durch den Fachkräftemangel, der ein internationales Phänomen ist", so StepStone-Sprecher Sascha Theisen gegenüber pressetext.
Wirtschaftlich gutes Image
Während zwei Drittel aller befragten Arbeitnehmer grundsätzlich Interesse an einer Stelle im Ausland haben, kommt Deutschland für ein Drittel als Zielland infrage. Damit belegt der EU-Staat Platz fünf auf der Liste der bei internationalen Spitzenkräften beliebtesten Staaten - und ist nach den USA, Großbritannien, Kanada und Australien das bestplatzierte nicht englischsprachige Land.
"Deutschland hat im Ausland wirtschaftlich gesehen ein starkes Image. Interessenten sehen die Stabilität der Wirtschaft und damit verbunden die gute Lebensqualität", erklärt Theisen. Die attraktivsten deutschen Städte sind aus Sicht potenzieller Jobwechsler Berlin, München, Hamburg und Frankfurt.
Junge, gut ausgebildete Menschen stehen einer Karriere in Deutschland besonders aufgeschlossen gegenüber: Die Mehrheit ist jünger als 35 Jahre, verfügt über einen Bachelor- oder Masterabschluss, möchte in den Bereichen IT, Beratung und Management arbeiten und hat Interesse an einer längerfristigen Anstellung in Deutschland. Von international rekrutierenden Unternehmen erwarten sie neben guten Beschäftigungsbedingungen auch aktive Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft am neuen Arbeitsort und beim Erlernen der deutschen Sprache. "Während große Unternehmen hier sehr vorbildlich sind, gibt es bei mittelständischen Unternehmen noch einige Hausaufgaben zu machen", betont Theisen.
Abwanderung als Gefahr
Aufschlussreich sind auch die deutschen Ergebnisse der Studie: Jede zweite Fach- und Führungskraft aus Deutschland ist interessiert an einer beruflichen Auslandserfahrung. Zwar fällt die Bereitschaft der deutschen Umfrageteilnehmer im internationalen Vergleich damit etwas geringer aus, die Zahl verdeutlicht aber die große Herausforderung, mit der Arbeitgeber sich heute auseinandersetzen müssen.
"Angesichts des Fachkräftemangels ist die potenzielle Abwanderung qualifizierter Mitarbeiter eine zusätzliche Bedrohung für deutsche Unternehmen. Sie stehen im Wettbewerb um die Top-Mitarbeiter nicht mehr nur in Konkurrenz zu anderen deutschen Unternehmen, sondern auch zu Arbeitgebern im Ausland, die Talente zunehmend aktiv anwerben", so Sebastian Dettmers, Geschäftsführer der StepStone Deutschland.
|
Bild oben: pixelio.de/berlinpics |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Bessere Noten fĂĽr schĂĽchterne Kinder
 |

Zürcher Forscher startet Pilotprojekt
Zürich (pte024/27.09.2011/12:00) - Der Erziehungswissenschafter Georg Stöckli von der Universität Zürich http://www.uzh.ch hat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das schüchternen Kindern helfen soll, ihre Kontaktängste zu überwinden. "Schüchterne Kinder haben oft Nachteile in der Schule. Sie sind sozial gehemmt und bekommen deshalb oft schlechtere Noten, weil ihre mündliche Beteiligung am Unterricht unterdurchschnittlich ist. Vor allem in den Sprachen macht sich das bemerkbar", sagt Stöckli im Gespräch mit pressetext.
Hilfe durch Übungen
Schüchternheit ist auch bei Kindern weit verbreitet. Normalerweise legen sich anfängliche Hemmungen recht schnell, wenn ein Kind sich an eine neue Situation gewöhnt hat. Bei acht Prozent der Kinder spricht man aber von stabiler Schüchternheit. "Damit sind mehr Kinder von stabiler Schüchternheit als von echter Aggressivität betroffen", so Stöckli. Diese Kinder werden auch in Fächern, in denen mündliche Mitarbeit weniger gefragt ist, oft schlechter benotet. "Aufgrund ihrer geringen sozialen Aktivität werden sie unterbewusst schlechter beurteilt. Von einem Kind wird erwartet, dass es von sich aus Freundschaften und Kontakte knüpft", erklärt der Wissenschaftler.
Das Programm von Stöckli richtet sich an Grundschüler und ist speziell auf die Unterrichtssituation ausgelegt. "Es soll Kindern helfen trotz ihrer Schüchternheit am Unterricht teilzunehmen", so Stöckli. Das Pilotprojekt ist vorerst auf die Stadt Zürich beschränkt. Alle Grundschullehrer können schüchterne Kinder melden, die Kinder können dann zehn Sitzungen zu je 90 Minuten besuchen. "Die Kinder machen in Kleingruppen Übungen wie Rollenspiele. Sie sollen auch lernen Leute auf der Straße anzusprechen. Sie bekommen auch Aufgaben, die sie außerhalb der Gruppen erledigen müssen, zum Beispiel die Kontaktaufnahme mit Mitschülern oder Lehrern", so Stöckli.
Ungewisse Zukunft
Momentan sind nur etwa zwölf Kinder an dem Pilotprojekt beteiligt. "Das kommt, weil die Lehrpersonen, die Kinder melden sollen, noch kein Auge für die Betroffenen haben. Es braucht erst Bewusstseinsbildung, denn schüchterne Kinder sind unauffällig und machen keinen Ärger", sagt Stöckli. Ob das Projekt Schule macht, ist noch offen. "Momentan finanziert ein privater Spender aus Norddeutschland, der selber schüchtern war, das Projekt. Die Finanzierung für eine Implementierung im größeren Rahmen müsste erst geklärt werden", sagt Stöckli. Die Erfolgsrate des Projekts ist laut dem Erziehungsexperten jedenfalls sehr hoch.
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
E-Reader gefährden Freiheit der Information
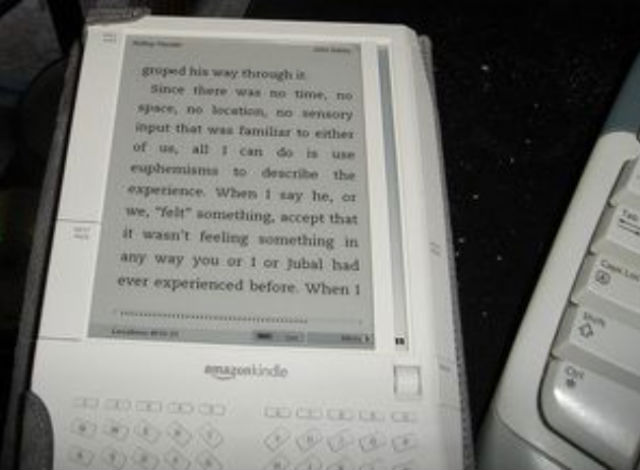 |
Kritiker: Erschwerter Zugang zum Lesen, Privatisierung des Wissens
Cambridge/Wien (pte024/26.09.2011/13:50) - Die derzeit stark promoteten E-Books können insbesondere für den unteren Rand der Gesellschaft zum Problem für eine demokratische Verbreitung von Wissen und Bildung werden, meinen Experten. Amazon http://amazon.de hat indes begonnen, E-Books in öffentliche Bibliotheken in den USA auszuliefern.
Öffentliches Gut in Gefahr
Der demokratische Zugang zu Wissen galt lang als öffentliches Gut: Bibliotheken wurden stets mit Steuereinnahmen oder von Philanthropen gestützt. Zumeist werden die ersten Erfahrungen von Kindern mit Büchern via "Second Hand" gemacht: Sie werden entweder von Familienmitgliedern weitergegeben oder gebraucht gekauft.
E-Books könnten diesen für die demokratische Verbreitung von Wissen so wichtigen Sekundärmarkt auslöschen und gleichzeitig den Büchereien die Kontrolle über Kopien eines Textes entziehen. Denn E-Books können nur begrenzt verliehen oder verkauft werden: Tatsächlich arbeiten Verleger daran, die Zahl der Verleih-Möglichkeiten in Bibliotheken auf 26 zu limitieren. Man kann E-Books auch nicht verschenken und nicht bei einem Streifzug durch endlose Bücherregale entdecken. Das Wissen aus Büchern, warnen Insider, wird bald Amazon und Co gehören.
Bibliotheken verlieren Rechte
"In wissenschaftlichen Bibliotheken gibt es auch bei uns schon E-Books. Speziell bei Zeitschriften tritt das gedruckte Material zunehmend in den Hintergrund. Derzeit wird aber in Büchereien versucht, beides zur Verfügung zu stellen", so Wolfgang Hamedinger, Geschäftsführer der österreichischen Bibliothekenverbund und Service GmbH http://www.obvsg.at/ auf Nachfrage von pressetext.
Gedrucktes bringt Lagerprobleme, wogegen bei E-Books Synergieeffekte zu erzielen sind. Andererseits halten die Bibliotheken nur bestimmte Rechte an einem E-Book, während das eigentliche Werk auf den Servern des jeweiligen Verlags lagert. Ob man dann noch Herr des Materials ist und wie es in 50 Jahren mit der Verfügbarkeit von Werken stehen wird sind laut Hamedinger politische Fragestellungen, von denen die Öffentlichkeit zu wenig mitbekomme.
Mehr Lese-Hürden für Kinder
Einen anderen Aspekt dieser Entwicklung stellen die E-Reader selbst dar: Hersteller könnten die Preise in Zukunft senken, aber auch auf einem bestimmten Niveau stagnieren lassen. Digitales Lesen könnte somit zusätzliche Barrieren zwischen den Leser und dem Wissen aufbauen, wie Rechte des geistigen Eigentums oder andere, subtilere. Während Kinder früher zum Lesen eines Buches nur das Lesen beherrschen mussten, stellt sich zunehmend die Frage, was Kinder ohne Zugang zu einem E-Reader in einer Welt des digitalen Lesens machen werden.
Bücher haben einen demokratisierenden Effekt auf Lernen. Sie sind unbedingt notwendig für die reibungsfreie Verbreitung von Information. Sie sind langlebig und billig zu produzieren. Ihre weite Verbreitung - ein Zustand, der von vielen für selbstverständlich gehalten wird - war in den vergangenen Jahrhunderten eine stetige Kraft, die eine informierte Bürgerschaft schuf. Im Lichte dieser Erwägungen bleibt es fraglich, ob die Gefährdung dieses Guts für ein Fortkommen im 21. Jahrhundert sinnvoll ist.
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben


 Wenn Du eine andere Person auf www.scroggin.info einlädst, weden Dir "150" Punkte auf Deinem Punktekonto gutgeschrieben!
Wenn Du eine andere Person auf www.scroggin.info einlädst, weden Dir "150" Punkte auf Deinem Punktekonto gutgeschrieben!